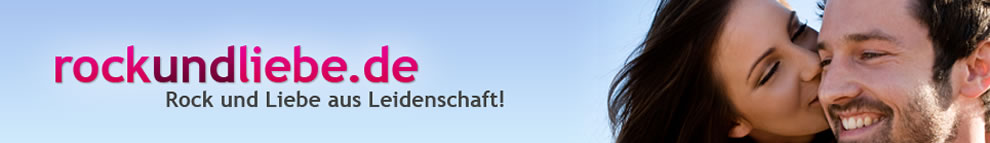
Die Kunst zu lieben - Teil 16
Autor: I.AMsterdam
veröffentlicht am: 06.07.2013
– Tag 16 –
Milan.
Ein einfacher Name, der bei mir schon seit Tagen, ja sogar Wochen, für immer mehr Kopfzerbrechen sorgt. Wie ein Virus hat er sich bei mir eingenistet, zuerst gar nicht wahrnehmbar, um dann urplötzlich mit voller Wucht der Hauptkern meiner Gedanken zu werden. Und obwohl mich diese Tatsache mehr denn je verwirrt, genieße ich dieses wohlige Gefühl. Es ist aufregend, fremd und so schön zugleich.
Unbeschreiblich.
Ich seufze leise und lasse meinen Blick aus dem Fenster schweifen, welches mit unzähligen Fingerabdrücken versehen ist. Es sieht so aus, als würde es jeden Moment anfangen zu regnen. Die dunkelgrauen Wolkenmassen am Himmel tauchen die Umgebung in einen düsteren Schatten, während ein scharfer Wind die bunten Blätter aufwirbelt.
Ich befinde mich gerade auf dem Rückweg von meinem Klavierunterricht und bin froh, dass ich die Stunden endlich hinter mir habe. Heute war ich sehr unkonzentriert, was auch Thorsten, mein Lehrer, seufzend feststellen musste.
Aber ich kann nichts dafür.
Milan schleicht in meinem Kopf rum, lenkt mich ab und macht es mir unmöglich, auch nur einen klaren Gedanken zu fassen. Es ist erschreckend, wie sehr eine einzige Person meine Gedankenwelt völlig einnehmen kann.
Ich erinnere mich an die letzte Woche, als ich Milan im Zug begegnet bin und wir in ein Gespräch gekommen sind. Er hat mir von seiner Mutter erzählt, die vor sechs Jahren beim Tauchen gestorben ist.
Es ist unglaublich, wie viel Zuversicht er trotz dieses Schicksalsschlags besitzt und er, der doch eigentlich von tiefer Trauer erfüllt sein müsste, mich, die im Grunde genommen nur von einer penetranten Familie aufgezogen wurde, immer wieder aufbaut. Müsste es nicht eigentlich genau andersherum sein?
Ich schrecke auf, als die monotone Computerstimme die nächste Haltestelle verkündet, meine Station. Schnell schultere ich meine Tasche und balanciere mit wackligen Beinen zum Ausgang, während der Zug zum Stehen kommt.
Die Türen öffnen sich und der eisige Wind peitscht mir ins Gesicht, wirbelt meine roten Haare auf. Hastig steige ich aus dem Zug und verlasse eiligen Schrittes den kleinen Bahnhof, die Arme fest vor der Brust verschränkt.
„Hey, Leona!“, vernehme ich da auf einmal eine Stimme, gar nicht so weit entfernt.
Verwirrt drehe ich mich um und erkenne Nia, die grinsend auf mich zugeht. Ich muss einfach an ihr vorbeigelaufen sein.
„Was machst du denn hier?“, frage ich sie perplex und werfe einen flüchtigen Blick auf meine Armbanduhr. Ich muss rechtzeitig zu Hause sein, immerhin habe ich immer noch Hausarrest dank der Party. Gestern konnte ich mich nur mit viel Müh und Not herausreden und meine Mutter überzeugen, in der Schule länger gewesen zu sein, um noch ein wenig in der Bücherei für ein neues Thema zu recherchieren, welches nach den Herbstferien unser Fokus werden soll. Morgen ist schon der letzte Schultag.
Nia legt leicht lächelnd den Kopf schief. „Hast du’s schon wieder vergessen? Den Plan, den ich errichtet habe?“
Siedend heiß läuft es mir den Rücken hinab. „Oh, ich… habe es tatsächlich vergessen“
Oder vielmehr verdrängt.
Doch mit einem Mal fallen mir ihre Worte von gestern wieder ein: Ich habe mir auch schon einen Plan zurecht gelegt, den ich die restliche Woche mit dir durchgehen werde. Jeden Tag werde ich dir beweisen, warum es sich lohnt zu leben.
„Dann ist es ja gut, dass ich dich wieder erinnere“, meint Nia und nimmt mich beim Ellenbogen, um mich vom Bahnhof wegzuführen.
Immer noch völlig irritiert stolpere ich ihr hinterher. „Aber, Nia… das geht nicht! Ich habe Hausarrest und wenn ich nicht rechtzeitig zu Hause bin–“
Die Brünette bleibt stehen und dreht sich zu mir um. „Hast du dich je dem Willen deiner Mutter einmal wiedersetzt? Irgendetwas Verbotenes getan, was dich total aufgekratzt hat?“
Verblüfft schaue ich sie an. „Außer der Party… nein“
„Dann auf in Runde 2“, entgegnet sie und grinst. „Komm schon, Leona, die Pubertät ist die Zeit, in der wir alle Blödsinnigkeiten machen dürfen, ohne dass es grotesk wirken würde, vielmehr erwartet man das sogar schon von uns. Ich meine, nicht umsonst wird die Jugend als »rebellische Phase« oder »die Zeit des Sturm und Drang« beschrieben. Und ich denke, wir sollten diesen Worten getreu werden, oder etwa nicht? Es wird endlich mal Zeit, dass du dich aus den Fäden deiner Mutter entreißt, damit du nicht mehr ihre Marionette bist“
Auch wenn mich der Gedanke reizt und mein Herz dadurch aufgeregt schneller schlägt, überwiegt bei mir die Skepsis. Argwöhnisch verziehe ich das Gesicht und schaue Nia prüfend an. „Ich habe gestern schon die Regel gebrochen, weil ich zu spät gekommen bin. Ich weiß nicht, wie ich meiner Mutter das heute erklären sollte“
„Sag doch einfach, du warst in einer lebensrettenden Aktion unterwegs. Immerhin ist das Projekt nur dafür da, um dir vor Augen zu führen, wie wertvoll das Leben eigentlich ist. Somit lügst du noch nicht einmal“
Ich seufze. „Nia…“
„Keine Widerrede! Jetzt lass uns hier nicht länger rumstehen, es fängt mit Sicherheit jeden Moment an zu regnen“, meint sie und zieht mich energisch vorwärts, scheinbar, um dem Thema auszuweichen.
Ich verdrehe seufzend die Augen und gebe meinen Protest auf, es hilft doch alles nichts. Also stolpere ich lustlos hinter ihr her. „Und wohin gehen wir genau?“
Nia wirft mir einen undefinierbaren Blick über die Schulter zu, während sie mich weiter den Bürgersteig fortzieht. Ihre Stimme klingt ernst, als sie antwortet: „Zu einem Ort, wo Leben und Tod sich unter einem Dach befinden“
••
Ein mulmiges Gefühl beschleicht mich, als meine Freundin mich zielsicher durch die fürchterlich sterilen, einfarbigen Flure des Krankenhauses führt. Unauffällig mustere ich die Besucher, welche entweder erschöpft und besorgt auf den Wartestühlen sitzen oder aufgeregt und mit angespannter Miene auf und ab gehen.
Ich schaudere.
Ich habe Krankenhäuser noch nie gemocht, sie strahlen für mich immer etwas sehr Bedrückendes aus, außerdem verbinde ich damit andauernd ein schlechtes Omen. Diese Machtlosigkeit, die Anspannung, die zitternde Hoffnung – diese dünne Grenze zwischen Leben und Tod, all das erzeugt bei mir ein leichtes Gefühl von Panik.
Und ich habe eine wage Vermutung, wieso Nia mich ausgerechnet hier hin geführt hat. Mein Mund wird vor lauter Nervosität staubtrocken.
Meine Freundin bleibt vor einer unscheinbaren Tür stehen, auf der in schwarzen Buchstaben Personal steht. Sie kennt sich hier scheinbar gut aus, ansonsten würde sie nicht so entschlossen anklopfen und ohne auf eine Antwort zu warten, die Türklinke hinunterdrücken.
Während ich ihr schweigend in das Innere folge, kommt mir der Geruch von Kaffee entgegen. Wir befinden uns in einem kleinen Aufenthaltsraum mit drei runden Tischen und je zwei Stühlen. An der Wand ist eine Küchenzeile, wo ich auch einen Kaffeeautomaten vorfinde, die Quelle des Geruchs. Der ganze Raum ist in schlichtem Weiß gehalten und wird von der grellen Röhrenlampe in ein seltsames Licht getaucht.
Nur zwei Leute befinden sich in dem Aufenthaltszimmer.
Zu meinem Erstaunen entdecke ich neben einer mir unbekannten Krankenschwester auch noch Nias Mutter. Beide schauen überrascht auf, als wir eintreten. Verdattert hebe ich die Augenbrauen hoch und schaue meine Freundin fragend an. Ihre Mutter arbeitet hier?
„Oh, hallo Nia!“, begrüßt Frau Ammedick ihre Tochter und stellt die Kaffeetasse, die sie zuvor noch in ihren Händen hielt, auf den Küchentresen. Sie streicht Nia einmal kurz über das Haar und schaut mich dann mit hochgezogenen Brauen an. „Was kann ich für euch tun?“
„Hast du einen Moment lang Zeit?“, fragt die Brünette ihre Mutter.
Diese wirft einen flüchtigen Blick auf die Uhr an der Wand. „Hm, ich habe noch fünf Minuten Pause…“
„Das reicht bestimmt“, sagt Nia entschlossen und bedeutet mir, mich auf einen der Stühle zu setzen. Schwerschluckend folge ich ihrer stummen Anweisung und lasse mich aufrecht und angespannt auf den Sitzplatz nieder.
Ich habe überhaupt keine Ahnung, was meine Freundin vorhat, und dieses Unwissen lässt meinen Puls vor Aufregung höher schlagen. Doch scheinbar bin ich nicht die einzige, die von ihrem Plan nichts wusste.
„Also, was ist los?“, fragt Nias Mutter und schaut verwirrt zwischen ihrer Tochter und mir hin und her. Die andere Krankenschwester spült derweil ihre Kaffeetasse ab und wechselt dann einen Blick mit Frau Ammedick, ehe sie den Aufenthaltsraum verlässt.
Ich komme mir vor wie ein Straftäter, der nun verhört werden soll.
Aber Nia macht mir schnell klar, dass nicht ich diejenige bin, die Fragen beantworten soll, sondern einfach nur zuhören muss.
Sie lehnt sich an dem Küchentresen und verschränkt die Arme vor der Brust. Ihr Blick ist ernst und beharrlich. „Mom, warum werden die Patienten hier in das Krankenhaus eingewiesen?“
Ihre Mutter schaut sie verständnislos an. „Ist die Frage ernst gemeint?“
„Bitte, Mom. Alle Fragen, die ich heute stellen werde, sind ernst gemeint. Beantworte sie einfach nur und ziehe sie nicht in Zweifel, okay?“
Frau Ammedick hebt die Augenbrauen und mustert ihre Tochter verwundert, ehe sie seufzend die Schultern sinken lässt und ihre Kaffeetasse wieder zur Hand nimmt. Resigniert hebt sie eine Hand. „Also, schön. Die Leute kommen in ein Klinikum, weil sie verletzt sind oder Krankheiten haben, welche wir dann versuchen zu heilen. Aber auch, damit wir ihnen bei der Geburt helfen können“
Nia nickt zufrieden. „Und was bewegt die Leute dazu, hierherzukommen?“
Ihre Mutter runzelt die Stirn. „Das ist doch logisch, sie wollen wieder gesund sein, am Leben bleiben“
„Die Leute sind also hier, weil sie nicht sterben wollen“, stellt Nia nüchtern fest und schaut mich an. Ich beiße mir auf die Unterlippe.
Nun scheint Frau Ammedick restlos verwirrt zu sein. „Natürlich wollen sie nicht sterben, deshalb gibt es ja Krankenhäuser. Die Menschen, die hier schwerverletzt eingeführt werden, wollen leben und sind jedem Arzt unglaublich dankbar, dass er ihnen hilft“
„Weil diese Menschen sich nicht vorstellen können zu sterben?“, hakt ihre Tochter scheinbar interessiert nach.
Nias Mutter nickt irritiert. „Ja. Aber andererseits gehört Sterbebegleitung auch zu den Aufgaben eines Krankenhauses“
Ich sehe, wie diese Aussage Nia aus dem Gleichgewicht bringt. Ein Schatten huscht über ihr Gesicht, und ihre energische, willensstarke Haltung verliert an Contenance. Traurig schaut sie ihre Mutter an und fragt leise: „Wie schlimm ist das, Sterbebegleitung?“
Diese senkt nun den Blick und nippt nachdenklich an ihrem Kaffee. „Man darf so etwas nicht zu nah an sich ranlassen, Nia. Was hier im Krankenhaus passiert, bleibt auch hier und sollte einen nicht weiterverfolgen. Menschen sterben hier und Menschen werden hier geboren. Die Schneide zwischen Leben und Tod liegt nirgendwo so nah beieinander wie in einem Krankenhaus. Ich habe durch meinen Beruf schon viel über die Wichtigkeit des Lebens gelernt. Jeder Tag ist ein Geschenk, kein gegebenes Recht. Viele sehen es schon als Privileg, jeden Morgen aufzustehen und lebendig zu sein. Dabei sterben täglich so viele, darunter auch noch sehr junge Leute, die ungeplant, ohne auch nur einmal vom Leben irgendwie gekostet zu haben, verunglücken oder durch eine Krankheit ableben müssen. Wir sollten dankbar sein, leben zu dürfen“
Stille.
In meinen Ohren rauscht es, während mein Atem immer flacher geht. Ich versuche irgendetwas im Raum zu fixieren, weiche Nias Blick aus, und spüre, wie sich ein Druck in mir aufbaut, dem ich nicht mehr lange standhalten kann.
Diese Worte von Nias Mutter… Noch nie habe ich jemanden so etwas sagen hören. Beileibe nicht. Ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht, wie gut ich es eigentlich im Vergleich zu anderen Menschen habe, die alles dafür tun würden, um nicht zu sterben.
Und ich?
Ich hebe den Kopf, begegne Nias aufmerksamen Blick und den nachdenklichen Augen ihrer Mutter. Wie heißt sie überhaupt?
„I-ich muss mal an die frische Luft“, stoße ich heiser hervor und erhebe mich ruckartig.
Frau Ammedick nickt langsam. „Ich sollte jetzt auch gehen“
Sie wirft ihrer Tochter einen vielsagenden Blick zu, der klar macht, dass diese sich heute noch auf ein Gespräch mit ihrer Mutter freuen kann.
Hastig stürme ich aus dem Aufenthaltsraum, laufe die Flure entlang und marschiere zum Ausgang. Ein gewaltiges Chaos herrscht in meinem Kopf, so verwirrend und undurchdringbar.
„Leona, warte!“, höre ich Nia rufen.
Doch ich gehe weiter, bis ich endlich den Ausgang erreicht habe und mir die wunderbar kühle Herbstluft entgegenkommt. Es hat angefangen zu regnen, einzelne Tropfen stürzen auf mich herab, als ich schließlich stehen bleibe.
Keuchend stoße ich die Luft aus, die kalte Luft kratzt in meinem Hals, doch es ist mir egal. Die Regentropfen benetzen mein Gesicht, verfangen sich in meinen Haaren und durchweichen meine Kleidung. Ich zittere.
„Leona…“
„Ich weiß, warum du das gemacht hast“, sage ich, immer noch mit dem Rücken zu Nia. Meine Lippen bilden eine schmale, bleistiftdünne Linie. „Ich habe es verstanden, okay? Ich habe es verstanden!“
Nia schweigt.
Ich starre auf den Boden, versuche meinen schnellen Atem zu beruhigen und lasse die Schultern sinken. Langsam drehe ich mich zu meiner Freundin um.
Sie steht vor den Eingangstüren des Krankenhauses, ein paar Meter von mir entfernt, wo sie sich unter dem überdachten Bereich Schutz vor dem Regen gesucht hat. Unsere Blicke treffen sich.
Sie beißt sich auf die Unterlippe. „Es ist nur so… Diese Leute hier würden alles dafür tun, um ein normales Leben zu führen, einfach zu überleben. Sie haben Angst zu sterben, Angst vor dem Tod“
Sie setzt einen Schritt nach vorne, kommt mir entgegen. Der Regen umhüllt sie sofort ein, als sie den sicheren, überdachten Eingang verlässt.
„Und du, du hattest vor, dieses wertvolle Geschenk, das Leben, einfach wegzuwerfen, weil du mit den Problemen nicht klar kamst. Aber das ist nicht richtig, Leona. Es gibt für alles eine Lösung, und ich will dir helfen. Du musst nicht alleine sein“
Ich halte den Atem an.
Sekunden verstreichen, in denen keiner ein einziges Wort sagt. Ich spüre, wie sich ein Kloß in meinem Hals bildet und versuche mühsam die aufsteigenden Tränen der Rührung wegzublinzeln. Vergeblich.
Nias Worte wärmen mich von innen, sind wie Balsam für meine geschundene Seele. Ich kann nichts dagegen tun; mit dem ersten lauten Schluchzer scheint die schweigende Mauer zwischen uns zu fallen. Nia kommt auf mich zu und drückt mich in ihre Arme. Ich klammere mich an sie fest, als wolle ich sie nie wieder loslassen. Es ist genau das, was ich jetzt brauche – eine tröstende Umarmung, während der Regen auf uns niederprasselt.
„Alles ist gut, Leona“, flüstert sie und hält mich fest. „Vielleicht habe ich es heute ein wenig übertrieben, es tut mir leid“
Ich erwidere nichts, genieße einfach nur diese Umarmung, dieses Gefühl von Geborgenheit und das Wissen, dass ich tatsächlich nicht alleine bin. Es überrollt mich alles, kommt so unerwartet.
„Ich wollte dir einfach nur so gut es geht klar machen, was für ein Glück du eigentlich hast“, fährt Nia leise fort.
Ich lächele schwach, was sie aber nicht sehen kann.
Ja, ich habe tatsächlich Glück.
Glück, so eine tolle Freundin wie Nia zu haben.
••
„Wo warst du?“
Die schneidende Stimme meiner Mutter erschreckt mich, als ich die Haustür hinter mir schließe. Langsam ziehe ich meine Schuhe aus, während ich nervös auf meiner Unterlippe kaue und ihr einen scheuen Blick zuwerfe.
„Du solltest schon längst wieder Zuhause sein, Leona! Also: Wo bist du gewesen?“, fragt sie streng und stemmt die Hände in die Hüfte.
In diesem Moment kommt Lydia die Treppe hinunterstolziert und verharrt überrascht auf der letzten Treppenstufe. Ihre Augenbrauen wandern nach oben und schnell weiche ich ihrem herablassenden Blick aus.
„I-ich…“, beginne ich stotternd und spiele mit dem Saum meines Oberteils. „Ich war mit Nia unterwegs. Es war wirklich dringend“
„Nia?“, wiederholt meine Mutter skeptisch und verzieht das Gesicht.
Gleich darauf höre ich das spöttische Lachen meiner älteren Schwester, die nun belustigt am Treppengeländer lehnt und sich scheinbar köstlich aufgrund meiner Hilflosigkeit amüsiert. „Was genau war denn bitteschön so wichtig?“
Ihre Frage klingt lauernd, genauso sieht auch ihr Grinsen aus, welches sie mir zuwirft. Ich presse die Lippen aufeinander, während ich versuche, den aufkeimenden Zorn zu zügeln. Tief atme ich durch. „Wir waren im Krankenhaus. Ihre Mutter besuchen“
Mama schnaubt und verschränkt die Arme vor der Brust. „Diese Nia ist ein schlechter Umgang für dich. Du hast dich verändert, seitdem du sie kennst; ich erkenne dich gar nicht wieder! Zuerst diese Party und jetzt auch noch das!“
Aufgebracht fuchtelt sie mit ihren Händen rum.
„Kind, was macht sie nur aus dir?“, fragt Mama kopfschüttelnd und stößt die Luft aus.
Ich knirsche mit den Zähnen und werfe meiner Mutter einen wütenden Blick zu. Wie kann sie nur so schlecht über Nia denken, obwohl sie die Brünette gar nicht kennt?
„Sie macht aus mir einen besseren Menschen“, antworte ich schließlich kühl und erwidere Mamas verwirrten Blick mit schmalen Augen. „Sie gibt mir das, was ich von dir nicht bekomme: Liebe, Freude, Zuversicht. Hoffnung. Ich gebe zu, dass ich mich verändert habe, seitdem sie meine beste Freundin ist, aber diese Veränderung hat mich gestärkt“
Meine Mutter sieht aus, als wäre sie aus allen Wolken gefallen. Ich erschrecke kurz, als mir bewusst wird, was ich da gerade laut ausgesprochen habe. Doch dann registriere ich mit Genugtuung den staunenden Blick meiner Schwester, die mich mit einer nicht zu kaschierenden Bewunderung anschaut.
„Ich bin ein freier Mensch, der selbst Entscheidungen treffen darf und kein Spielzeug, welches man hier und da mal kurz benutzt. Nia hat mir die Augen geöffnet und mir gezeigt, dass Unabhängigkeit und Freiheit wertvolle Elemente sind, die ich mit Sicherheit nicht einfach wegwerfen werde, weil meine Mutter von der Gesellschaft und dem äußeren Schein so besessen ist, dass sie skrupellos sogar ihre eigene Tochter als Marionette benutzt. Und die andere sogar zu einem Klon hat mutieren lassen“
Ich werfe meiner Schwester einen vielsagenden Blick zu, die schwer schluckt. Sie sieht ein wenig blass aus.
„Aber ich bin ein Individuum, keine billige Kopie. Und ich bin stolz darauf. Ich bin stolz darauf, eine so tolle Freundin wie Nia zu haben und würde alles dafür tun, um meine Familie umzutauschen“
Empört schnappt meine Mutter bei meinen feindseligen Worten nach Luft.
Ich spüre, wie eine große Last von mir abfällt, denn endlich habe ich diese Worte ausgesprochen, meine Gedanken laut werden lassen.
Aber im nächsten Moment verlässt mich wieder der Mut und die Angst vor Mamas Reaktion packt mich. Diese ist schon vor lauter Ärger rot angelaufen.
„Wie… kannst du es wagen?“, zischt sie und presst ihre Zähne aufeinander. Eine Ader pocht an ihrer Stirn. „Du bist eine Schande für die Familie! Ich will, dass du dich nicht mehr mit Nia triffst. Und dein Hausarrest verlängert sich! Und wehe dir, du kommst noch einmal zu spät, dann werde ich dich auf ein Internat schicken!“
Erschrocken weiche ich zurück.
Meine Mutter wirbelt herum und entfernt sich mit stampfenden Schritten von mir. Wie erstarrt bleibe ich stehen und lausche ihrem Abgang. Mit jedem verhallendem Schritt spüre ich, wie mein Herz mir immer weiter in die Hose rutscht.
Vorsichtig schiele ich zu Lydia, die mich mit einer Mischung aus Wut, Fraglosigkeit und – bilde ich mir das ein? – Anerkennung anschaut.
Ich blinzele ein paar Mal.
Meine Schwester schnaubt, macht auf den Absatz kehrt und geht wieder die Treppe hoch, lässt mich allein im Flur zurück.
Ich hatte erwartet, dass ich mich nach meinem Monolog besser fühlen würde, irgendwie befreiter.
Mal wieder liege ich ganz schön falsch.
__________________________
Ich würde dieses Kapitel eher als „so lala“ einstufen.
Es passiert nicht viel, aber dennoch fand ich es irgendwie wichtig dieses Übergangskapitel mit einzubauen. Vor allem, weil Leonas Vortrag zum Schluss noch einen entscheidenden Dominoeffekt haben wird… ;-)
Aber ich kann euch versprechen, dass der nächste Teil umso interessanter wird. Ich bin schon fleißig am weiter schreiben und hoffe, dass ich das nächste Kapitel bald fertig habe.
Liebe Grüße!
Teil 1 Teil 2 Teil 3 Teil 4 Teil 5 Teil 6 Teil 7 Teil 8 Teil 9 Teil 10 Teil 11 Teil 12 Teil 13 Teil 14 Teil 15 Teil 16 Teil 17 Teil 18 Teil 19
© rockundliebe.de - Impressum Datenschutz