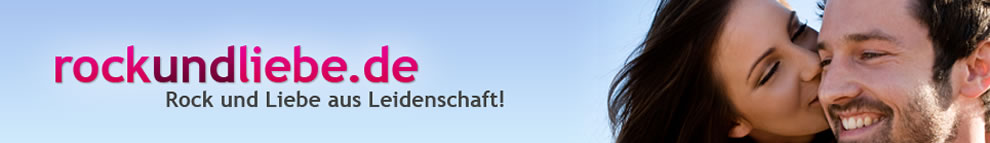
Die Kunst zu lieben - Teil 3
Autor: I.AMsterdam
veröffentlicht am: 13.11.2012
- Tag 2 -
Heute habe ich in meinen Notizblock für den Countdown - schließlich sterbe ich in 19 Tagen - eine Blume gemalt. Und zwar nicht irgendeine.
Es ist die Vergiss mein nicht.
Fünf blaue Blüten und eine gelbe Mitte. Wunderschön.
Ich frage mich, ob man auf meiner Beerdigung auch die Vergiss mein nicht auf mein Grab liegen wird. Oder wie es überhaupt aussehen mag.
Ich kann es mir nicht vorstellen.
Kopfschüttelnd setze ich mich an meinen Schreibtisch, hole den großen Ordner hervor, in denen ich meine unvollendeten Werke eingeheftet habe, und blättere ein paar Seiten durch. Allesamt sind es selbstgeschriebene Geschichten, die kein Ende besitzen, weil mir irgendwann die Lust verflogen ist.
Ich mag es zu schreiben oder gar zu lesen. Es ist eine gute Ablenkung, die mich schon des Öfteren von dem alttäglichen Trubel gerettet hat. – Aber letztendlich ist es nichts, was mich auch vor meiner Entscheidung „gerettet“ hätte.
Manchmal klicke ich mich auch durchs Internet durch und lese die Storys von Hobby-Schreiberlingen. Dabei ist mir schnell ein Stereotyp aufgefallen:
Die meisten Geschichten beginnen an einem Montagmorgen.
Grausam und schrill wird die Protagonistin aus ihrem besinnlichen Schlaf gerissen, die schlechte Laune ist somit schon vorprogrammiert. Meistens wird dann die Schuld auf den fiesen Wecker geschoben, welcher mit allerlei Verwünschungen von seinem Opfer konfrontiert oder - in aufbrausenden Momenten - in einem Akt der Überreaktion gegen die Wand geschmissen wird.
Dabei macht er nur seinen Job.
Danach wird der alltägliche Weg zur Schule beschrieben, die Hauptperson stapft mit einer bekannten Lustlosigkeit zu dem für ihn schlimmsten Ort auf Erden. Dort angekommen, verpufft der Missmut mit einem Mal, als der Figur und seiner durch und durch albernen Klasse, der neue gutaussehende Schüler vorgestellt wird.
Herzklopfen, Begeisterung und entzücktes Seufzen. Der Traumprinz schlechthin darf sich dann - Oh Wunder, oh Wunder - neben das Mädchen der Geschichte setzen, wo sich, natürlich, der einzige freie Platz noch befindet. Die giftigen Blicke von der Klassendiva mit blondierten Haaren und übertrieben geschminkten Gesicht ignorierend, schmilzt das Herz der Protagonistin dahin, als der Neuankömmling ihr ein charmantes Lächeln zuwirft.
Die Liebesgeschichte nimmt seinen Lauf, ein paar Hürden müssen erklommen werden, ehe das Happy End freudestrahlend und herzerwärmend die beiden füreinander bestimmten Personen aus ihrem Elend befreit.
Ende.
Ich seufze.
Manchmal wünsche ich mir, dass mein Leben auch so einfach wäre. In Büchern und Filmen ist meistens alles so wunderbar fantastisch, die Charaktere haben einfach immer Glück. Gemeinheit!
Nun, ich kann es eben nicht ändern.
Und ich habe mich entschlossen: Ich werde sterben.
„Leona!“
Die schneidende Stimme meiner Mutter, die ein wirklich sehr lautes Organ hat, holt mich aus meinen trübseligen Gedanken und lässt mich überrascht zusammenzucken.
Hastig lege ich den Ordner wieder zurück und öffne meine Tür einen Spalt breit.
„Jaaa?“
„Thorsten hat angerufen. Klavierunterricht fällt heute aus“, teilt sie mir mit einem grimmigen Unterton in der Stimme mit. „Er hat auch die Grippe, die zurzeit wieder die Runde macht“
„Hm, okay“
„Wenn Lydia Zuhause ist, werde ich ihr sagen, dass sie mit dir ein bisschen üben soll“, fährt sie fort und nun klingt sie ein wenig erfreuter. Im Gegensatz zu mir.
Ich seufze genervt. „Muss das sein?“
„Keine Widerworte!“, ertönt ihre scharfe Stimme von unten. „Sie ist eine sehr gute Pianistin und du kannst noch viel von ihr lernen.“
„Ist gut“, erwidere ich augenverdrehend, was sie zum Glück nicht sehen kann, und schließe wieder meine Zimmertür.
Meine Schwester ist 21 Jahre alt und studiert zurzeit Medizin in einer naheliegenden Großstadt. Doch die Idee, eine eigene Wohnung zu besitzen oder gar in einer Wohngemeinschaft zu hausen, ist ihr bisher noch nicht eingefallen. Stattdessen lässt sie sich lieber weiterhin von Mama betätscheln und verwöhnen.
Mit zwölf habe ich angefangen Klavier zu spielen, obwohl ich es eigentlich nie wirklich wollte. Doch Mamas ständiges und sehr hartnäckiges Drängen hat mich irgendwann katapultieren lassen, so dass ich mich schließlich brummend dem Willen meiner Mutter gebeugt habe.
Dadurch kann sie mich - wie ich zu spät festgestellt habe - noch mehr fertig machen,
indem sie meine Fähigkeiten immer wieder mit denen von Lydia vergleicht, die schon seit ihrem siebten Lebensjahr das Piano als ihren besten Freund bezeichnen kann.
Wenn ich so darüber nachdenke, könnte ich in meinem Fall einzig und allein den Stift als meinen besten Freund bezeichnen, der mich wohl nie im Stich lässt.
Aber was zählen schon materielle Dinge?
Eine Stunde später sitze ich mit Kopfschmerzen und zusammengepressten Zähnen auf dem Klavierhocker, die Finger über die Tasten schweifend, während Lydia mit verschränkten Armen neben mir steht.
„Falsch!“, ertönt sofort ihre sirenenartige Stimme. „Du hast einen Ton zu tief gespielt. Das muss ein D sein und kein C!“
„Ich weiß, ich habe es gehört“, gifte ich.
Da ist mein Finger einmal ausversehen auf die andere Note abgerutscht, bekommt meine ältere Schwester schon gleich einen halben Herzinfarkt. Entschuldigung, dass es mich nicht im Perfekt-Modus gibt.
Ich spiele die gleiche Melodie noch einmal, diesmal ohne einen Fehler - meiner Meinung nach. Aber bei Lydia gibt es kein richtig, sondern nur falsch, falsch und nochmals falsch. Alles was ich mache ist - ratet mal? - falsch.
„Das musst du schneller spielen, noch war das viel zu langsam“, kritisiert sie mich in einem herabfallenden Ton und fordert mich auf, erneut die Tasten zu drücken.
In diesem Moment kommt unsere Mutter in das Klavierzimmer und hebt in einer stummen Frage die Augenbrauen.
„Leona muss noch sehr viel üben.“, beginnt Lydia sofort mit ihrem Protokoll und setzt dabei die gleiche hochnäsige Miene auf wie Mama. „Ich frage mich, was Thorsten sich bei solch einer schlechten Pianistin denken muss.“
Mama hebt ihre Mundwinkel zu einem verzerrten, stolzen Lächeln. „Du weißt doch, Schatz, dass nicht jeder so gut sein kann wie du.“
Ihr Blick fällt auf mich und sofort zieht sie ihre Nase krumm.
„Leona, ich hoffe, dass sich die vielen Klavierstunden noch irgendwann bezahlt machen. Du machst uns noch arm, Kind!“, sagt sie und bedeutet mir mit einem kurzen Nicken, aufstehen zu dürfen.
Ich schlucke den Kloß in meinem Hals hinunter und rausche schnell aus dem Raum. Mühsam versuche ich die plötzlich aufsteigenden Tränen der Wut und Enttäuschung zurückhalten, presse die Lippen zu einer bleistiftdünnen Linie zusammen.
Nicht schwach werden, rufe ich mir zornig ins Gedächtnis und atme tief durch. Doch im nächsten Moment lache ich verbittert auf und wische mir die Tränen, die sich leider doch einen Weg nach draußen gebahnt haben, aus dem Gesicht.
Ich bin schwach.
Ansonsten würde ich das alles nicht tun.
Ansonsten würde ich mich nicht für die letzte Möglichkeit entscheiden, die mir geboten wird.
Am liebsten würde ich schon heute mein Vorhaben in die Tat umsetzen, doch ich beherrsche mich und erinnere mich an den Countdown im Notizblock. Ich habe alles genau durchdacht, da darf mich jetzt kein Zwischenfall aus dem Konzept bringen!
Ich muss Ruhe bewahren.
Hastig schnappe ich mir meine Jacke, schlüpfe ungeduldig in die Schuhe und reiße abrupt die Haustür auf. Schnellen Schrittes verlasse ich das Grundstück, verlasse meine gehasste Familie, verlasse die Hölle.
Um mich irgendwie abzulenken, beginne ich zu zählen - ein beruhigendes Mittel, was mir schon oft geholfen hat. Ich zähle die Häuser, die Nummernschilder, die Autos, meine Schritte.
Ein kühler Wind wirbelt die bunten Blätter auf, welche alle in den unterschiedlichsten Facetten des Sonnenuntergangs gefärbt sind. Die knorrigen Äste erzittern unter der heftigen Windböe, der leise über die Landschaft pfeift.
Wie ein Ruf.
Ich laufe in den naheliegenden Wald, meinem Lieblingsort, und versuche durch die frische, kalte Luft wieder einen klaren Kopf zu bekommen. Es scheint, als würde die kühle Brise ihre imaginären Hände nach mir ausstrecken, mich sanft im geröteten Gesicht streicheln und versuchen, sich unter der Jacke zu verstecken.
Schaudernd hebe ich die Schultern und streiche mir ein paar widerspenstige Strähnen hinter das Ohr zurück.
Mit einem Seufzen lasse ich mich auf die Sitzbank nieder, dessen verwitterter Lack schon absplittert, und winkele die Beine an. Es kommt oft vor, dass ich genau wegen solchen Vorfällen Flucht in der Natur suche, so wie jetzt. An solch friedlichen, echten Orten fühle ich mich am wohlsten. Hier ist nichts gekünstelt, verstellt. Man erwartet nichts von mir. Man akzeptiert mich.
Mein Blick schweift zum Horizont, wo der Himmel sich allmählich ein Beispiel an den herbstroten Blättern nimmt und sich in ein helles Orange, Gelb und Rot verfärbt, die allesamt ineinander verlaufen.
Es ist ein schöner Anblick, der mich sehnsüchtig seufzen lässt. Allmählich beginnen die Tränen zu versiegen, hinterlassen eine klebrige Spur auf meiner Haut. Ich mag es nicht zu weinen. Weinen bedeutet, dass man schwach ist.
Aber andererseits…
Schwäche zeigen zu können ist eine Stärke.
Doch ich bin nicht stark.
– Ach, was weiß ich.
Alles ist gut, alles ist böse. Würde es nichts Gutes geben, gäbe es auch nichts Böses. Dann wäre die Welt neutral.
Ich schließe die Augen, lege meinen Kopf in den Nacken und genieße für einen kurzen Moment die wärmenden Sonnenstrahlen im Gesicht.
Einige Minuten sitze ich so da.
Doch irgendwann beginnt mein Nacken zu protestieren, weshalb ich mich von der Sitzbank erhebe und ein Gähnen unterdrücke. Meine Glieder fühlen sich steif und ungelenk an, seufzend fahre ich mir durch das Haar und marschiere gemächlichen Schrittes den kleinen Waldweg für Besucher entlang.
Zu meiner Linken plätschert der breite Fluss, welcher sich ziemlich nah am Pfad entlang schlängelt. Gleich dahinten befindet sich die Brücke - mein baldiges Todesurteil.
Ich gehe langsam.
Ich habe lange darüber nachgedacht, wie ich sterben will. Eigentlich wollte ich mir eine Überdosis Schlaftabletten einflößen, meine Mutter hat davon tausende Zuhause, und es kam mir nicht so schrecklich vor. Doch diesen Plan habe ich schnell wieder vergessen, als ich mich darüber genauer im Internet erkundigt habe. Ein paar Leute haben von ihren Erfahrungen berichtet und erzählt, dass es sehr schmerzvoll sein kann. Außerdem stirbt man nicht unbedingt.
Also habe ich mich anders entschieden. Denn ich will sicher sein.
Mit geschlossenen Augen lausche ich dem tobenden Wind, vernehme das Rascheln der Blätter und das aufmüpfige Rauschen des Flusses, dessen starke Strömung säuselnd der Brücke entgegenfließt.
Als ich die Augen wieder öffne, bin ich dem hölzernen Übergang schon ein Stück näher gekommen.
In meinem Kopf plane ich schon den Ablauf für meinen Geburtstag. Wie es sich wohl anfühlen wird, wenn ich in 19 Tagen genau diesen Weg entlang marschiere, mit dem Wissen, in ein paar Minuten tot zu sein?
Ich bekomme Gänsehaut.
In mir drin ist alles ruhig und still, als wäre ich schon tot. Diese Entschlossenheit gibt mir irgendwie Mut und Sicherheit. Dennoch würde ich am liebsten noch gerne von jemandem hören, dass ich das Richtige tue. Dass es nicht falsch ist. Dass jeder mich verstehen kann und genauso handeln würde.
Mein Herz wird ein wenig schwerer, als ich nun die Brücke hinaufgehe. Ein leichtes Zittern erfasst mich, schroff presse ich meine bebenden Lippen aufeinander. Viele Leute begehen in einer unüberlegten Handlung Selbstmord, überstürzen das Ganze. Doch ich habe mir alles ganz genau überlegt.
Niemand kann mir Vorwürfe machen.
Als ich den höchsten Punkt der Brücke erreiche, werfe ich einen vorsichtigen Blick nach unten auf das Wasser. Dort befindet sich eine gefährliche Stromschnelle, Steine ragen heraus, erheben sich gegen das schäumende Gewässer. Ich weiß, dass es dort sehr flach ist und es viele Brocken gibt.
Ich hoffe, dass ich in 19 Tagen sofort sterben werde. Und mich niemand sieht. Denn Zeugen sind wirklich das letzte, was ich gebrauchen könnte.
Noch schlägt mein Herz.
Noch pulsiert das Blut durch meine Adern.
Noch.
Ich höre das Knarren der Bodenbretter, als auf einmal eine weitere Person die Brücke überquert. Aus den Augenwinkeln erkenne ich den Jungen und straffe augenblicklich meine Schultern.
Stur schaue ich geradeaus.
Kurz stockt er, nur für einen winzigen Moment, ehe er sich wieder in Bewegung setzt. Mit steifen, schnellen Schritten geht Milan an mir vorbei.
Ich halte den Atem an, erwarte, dass er irgendetwas Bissiges sagt. Doch er bleibt stumm, marschiert weiter und dreht sich erst zu mir um, als er die andere Seite der Brücke erreicht hat.
Es ist nur ein kurzer Blick über die Schulter, aber das reicht schon aus, um mich hart schlucken zu lassen. Seine Augenbrauen sind zusammengezogen, die Miene düster.
Mein Magen zieht sich zusammen.
Seine grauen Augen scheinen Funken zu sprühen, sie erinnern mich auf einmal an Gewitterwolken mit maliziösen Blitzen, die die Tiefen meiner Seele erreichen. Ich schaudere, ziehe die Schultern hoch.
– Und genau in diesem Moment ertönt eine laute, panische Stimme, die die beruhigende Naturstelle und somit auch den grimmigen Augenkontakt zerreißt.
„Hilfe!“
Meine Augen weiten sich, als ich den verzweifelten Ruf eines Kindes höre. Und das noch nicht einmal sehr weit entfernt.
„Bitte, ich habe Angst!“
Ich kann sehen, wie Milans Augen zur Seite schwenken und er etwas fixiert. Seine Lippen pressen sich aufeinander.
Hastig und ohne einen weiteren Gedanken daran zu verschwenden, setze ich mich in Bewegung, laufe die Brücke denselben Weg wieder hinunter und lasse meinen Blick suchend über die vielen Bäume gleiten.
Nebenbei bemerke ich, dass Milan verschwunden ist. Er hat sich einfach aus dem Staub gemacht, scheint dem Betroffenen nicht helfen zu wollen.
Ich kann es nicht fassen!
Eine unglaubliche Wut auf diesen Jungen macht sich in mir breit, lässt mich erzürnt mit den Zähnen knirschen. Doch das ist jetzt unwichtig.
Ich renne den Waldweg entlang, höre einen spitzen Schrei und bleibe im nächsten Moment abrupt stehen. Meine Probleme, der Selbstmord, die Brücke sind vergessen. Für einen Augenblick.
Stattdessen setzt mein Herzschlag für eine Sekunde aus, als ich das kleine Mädchen entdecke, welches sich mit beiden Händen mühsam an einen Ast klammert, der über den Fluss ragt, während ihre Beine in der Luft baumeln.
Unter ihr das tosende Gewässer.
Grotesk.
Anders kann ich die Situation nicht beschreiben, als ich den Baum hinaufklettere und beide Beine über den dicken Ast schwinge, so dass ich ein wenig unsicher zum Sitzen komme. Mein Herz donnert in einem wilden Tempo gegen die Brust und ich kann das Adrenalin durch meine Venen pulsieren spüren.
Es ist berauschend. Diese Lebendigkeit.
Ich weiß nicht, ob es eine Art Beschützerinstinkt, vielleicht auch Zivilcourage ist, die mich da leitet. Auf jeden Fall bin ich froh, dass die Sorge meine Angst ein wenig nach hinten treibt und die Entschlossenheit, dem Kind zu helfen, die Oberhand gewinnt.
Das kleine Mädchen zappelt hilflos umher, weint jämmerlich und schaut mich, die hart schlucken muss, flehend an. Unter uns befindet sich eine sehr starke Strömung, die von den Stromschnellen unter der Brücke ausgeht.
Warum ist das kleine Mädchen auch ausgerechnet auf diesen Baum direkt am Wasser geklettert, auf diesen Ast, der über den Fluss ragt? Ich schüttele den Kopf, schiebe die Fragen bei Seite und konzentriere mich nun auf das Wesentliche.
„Nimm meine Hand!“, befehle ich mit harscher Stimme und strecke meinen Arm nach dem Mädchen aus, welches sich fest an den Stamm klammert, während ihre Beine in der Luft baumeln.
„Ich kann nicht!“
„Doch, du kannst!“
„Dann falle ich aber!“, protestiert sie.
„Ich halte dich fest“, verspreche ich und versuche meine Stimme ruhig klingen zu lassen. Ich rutsche ein wenig weiter nach vorne auf den Ast, habe aber Angst, dieser könnte unter meinem Gewicht zerbrechen. „Du musst mir nur deine Hand geben“
„Nein!“
Ich beiße mir auf die Unterlippe, rutsche noch ein wenig weiter vor, so dass ich die Hände der Kleinen zu packen bekomme. Scharf zieht sie die Luft ein und blickt unsicher zu mir hoch.
Nackte Angst ist in ihren Augen zu lesen. Todesangst.
„Ich will dir helfen“, beschwichtige ich sie und umfasse ihre Handgelenke. „Und ich werde dich gleich hochziehen und nicht loslassen. Du kannst mir vertrauen“
Sie presst ihre bebenden Lippen aufeinander, nickt aber schließlich.
Gott sei Dank.
Ich versuche das tosende Wasser unter uns zu ignorieren, spanne meine Muskeln an und zerre im nächsten Moment das kleine Mädchen mit meiner ganzen Kraft hoch. Verängstigt kneift sie die Augen zusammen, während ich große Mühe habe, das Gleichgewicht beizubehalten. Doch ich schaffe es. Am liebsten hätte ich erleichtert aufgelacht, als das verschreckte Kind endlich auf den Ast vor mir zum Sitzen kommt und sich ängstlich an mich festklammert.
Ihr ganzer Körper zittert und sie weint leise.
„Jetzt müssen wir nur noch wieder hinunter kommen“, murmele ich und gönne der Kleinen erst einmal eine kurze Verschnaufpause.
Gleich darauf höre ich auf einmal, wie sich schnelle Schritte nähern und dann abrupt stehen bleiben. Ich drehe den Kopf nach hinten, in Erwartung Milan zu sehen, und erstarre, als ich das mir bekannte Mädchen entdecke.
Nia.
Das muss ein schlechter Scherz vom Schicksal sein.
Eindeutig.
Zuerst treffe ich Milan und jetzt auch noch sie?
Ich glaube, das Leben spielt mir einen Streich.
„Céline?“, fragt Nia perplex.
Das Mädchen in meinen Armen regt sich und hebt vorsichtig den Kopf. Im nächsten Moment hellt sich ihr verweintes Gesicht auf und sie strahlt über das ganze Gesicht.
„Nia!“, ruft sie freudig aus.
„Was machst du da oben und - weinst du?“, will meine Mitschülerin schockiert wissen und tretet näher an den Baum. Die Sorge ist ihr ins Gesicht geschrieben.
„Oh, Nia! Ich wäre beinahe gefallen, aber sie hat mich gerettet!“, erklärt Céline und ich kann eine seltsame Mischung aus Angst, Erleichterung und so etwas wie Stolz in ihrer Stimme schwanken hören.
„Gerettet?“, wiederholt Nia verwundert und wirft mir einen skeptischen Blick zu.
Sofort versteife ich mich.
„Bitte, Nia! Ich will runter!“, jammert das kleine Mädchen und zieht eine Schnute.
„Wie bist du raufgekommen?“, fragt die Angesprochene.
„Geklettert“
„Dann klettere wieder runter“
„Ich habe Angst!“, meint Céline und rückt wieder näher an mich.
Nia seufzt und fährt sich mit der Hand durch das schlammbraune Haar. Scheinbar ist sie genauso ratlos wie ich. Super. Dann bin ich wenigstens nicht die einzige, die diese Lage auch sehr ungünstig findet.
„Gemeinsam schaffen wir das“, ermutige ich das kleine Mädchen freundlich, ziehe sie dicht an mich und drehe mich mit ihr auf dem Ast um, so dass unsere Blickrichtung genau auf dem Baumstamm gerichtet ist.
Ein leises, protestierendes Knirschen ertönt.
Erschrocken zucke ich zusammen und stellte entsetzt fest, dass sich ein kleiner Einschnitt in der Rinde des Astes befindet, welcher von Sekunde zu Sekunde größer wird. Erst da bemerke ich, dass das Geäst langsam zu sinken beginnt.
Scheiße!
„Hol sie runter, verdammt, der Ast bricht ab!“, befehle ich barsch.
Ein wenig erschrocken schaut Nia mich an, ehe sie schlauerweise schnell meiner Aufforderung nachkommt, näher tretet und die Arme nach oben streckt, um Céline zu empfangen, die ich nun vorsichtig nach unten hieve.
Ich spüre wie sich ein panischer Druck in mir aufbaut, der mich leicht verzweifelt werden lässt. Der Ast sinkt immer weiter, und mit dem Ast auch ich.
„Hab sie“, ertönt Nias gepresste Stimme.
Ich habe noch nicht einmal Zeit, Erleichterung zu verspüren.
Denn kaum hat sie die Worte ausgesprochen, höre ich ein lautes Knacken – und im nächsten Moment falle ich ruckartig in die Tiefe.
______________
An dieser Stelle möchte ich mich erst einmal herzlich für eure lieben Kommentare bedanken! :-*
Außerdem will ich noch erwähnen, dass ich dieses Kapitel eigentlich nur für einen Teil geplant habe, der aber zu groß geworden wäre, so dass ich das separat gemacht habe. Der nächste Teil, der direkt am Geschehen anschließt, wird dann - hoffentlich - morgen erscheinen ;-)
LG
Teil 1 Teil 2 Teil 3 Teil 4 Teil 5 Teil 6 Teil 7 Teil 8 Teil 9 Teil 10 Teil 11 Teil 12 Teil 13 Teil 14 Teil 15 Teil 16 Teil 17 Teil 18 Teil 19
© rockundliebe.de - Impressum Datenschutz