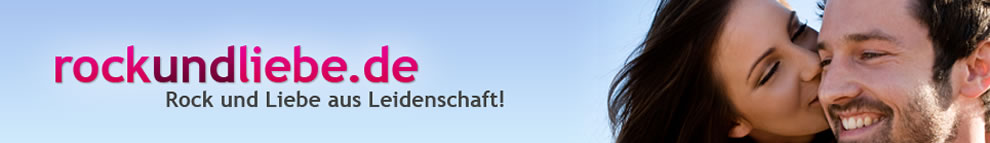
Die Kunst zu lieben
Autor: I.AMsterdam
veröffentlicht am: 06.11.2012
- Start -
7. Oktober
Der heutige Tag könnte so unschuldig sein.
Wie jeder andere.
Er könnte so unbedeutend, alltäglich sein, dass er einfach in der Masse untergeht. Ein Tag, den man spätestens in einer Woche wieder vergessen hat. Ein einziger Tag.
Doch haftet eine schwerwiegende Entscheidung an ihm, die ihn auf einmal sehr außergewöhnlich macht. Besonders.
Zumindest für mich.
All die anderen Menschen sind unwissend. Sie stecken in der Routine fest, schenken der Einförmigkeit keine Aufmerksamkeit mehr, beachten die kleinen Dinge des Lebens nicht.
Doch ich will heute ausbrechen.
Heute ist der Anfang. Und gleichzeitig das Ende.
Ein erleichtertes Seufzen entflieht meinen Lippen, als die Schulklingel ertönt, welche das Ende des Unterrichtes ankündigt. Für mich symbolisiert sie in diesem Moment ein Startsignal. Mein heimliches Projekt, worüber ich sehr lange nachgedacht habe, beginnt heute. Und niemand weiß es.
Gemeinsam mit den anderen Schülern aus meinem Kurs packe ich meine Sachen zusammen, erhebe mich und verlasse schon beinahe fluchtartig den Klassenraum.
Es ist ein seltsames Gefühl mehr zu wissen als die anderen.
Ich lasse meinen Blick über die vielen Gymnasiasten schweifen, welche allesamt locker in ihren Gruppen miteinander plaudern, sich mit einem Lächeln verabschieden.
Keiner ahnt, was in mir vorgeht.
Nun, ich interessiere sie ja auch nicht. Nicht wirklich. In jedem von ihnen kann ich einen Schuldigen sehen, einen Verantwortlichen. Sie alle - und noch mehr - haben mich zu diesem Entschluss geleitet.
Mein Stichtag ist in drei Wochen.
Und damit meine ich wirklich, dass dies mein Fälligkeitsdatum ist. Mein Todestag, um es auf den Punkt zu bringen. Ich verspüre deswegen keine Trauer oder Angst. Nein, zu lange habe ich mich schon mit dem Gedanken beschäftigt, als das noch irgendwelche Zweifel in mir auftauchen könnten.
Meine Entscheidung steht fest.
Es gibt kein Zurück.
Mit lockeren Schritten verlasse ich das Schulgebäude.
Als ich die Türen aufstoße, muss ich ergriffen die Augen zusammenkneifen, denn das Sonnenlicht blendet mich. Heute ist ein wunderschöner, aber ungewöhnlich kalter Herbsttag. Der Beginn - das Ende.
„He, Leona!“
Im Gehen drehe ich mich um und bereue es noch im selben Moment.
Jenny und ihre Clique aus Analphabeten, die alle der Beweis dafür sind, dass nicht jeder Schüler für das Gymnasium geeignet ist, grinsen mich gehässig an.
Sie alle halten eine Zigarette in der Hand und stehen in einem Halbkreis in der Raucherecke, und saugen wie die Bekloppten an ihrem Glimmstängel. Ihr dümmliches Lächeln sorgt bei mir nur für Ekel, als ich deren gelbe Zähne sehe.
„Ich hab gehört, du sollst dem alten Herrn Flegel einen geblasen haben!“, brüllt sie und lacht wie eine Hyäne. „Damit du die 15 Punkte in deinem Politikvortrag bekommst!“
Ich drehe mich wieder um und ignoriere das Gelächter der Idioten und die gaffenden Blicke der anderen Schüler. Einige schauen mich angewidert an, während andere wiederrum sich ein spöttisches Lächeln verkneifen müssen.
Und ich habe mich schon gewundert, dass der Tag heute so ruhig verlaufen ist. Aber natürlich würde man mir auch heute keine Ruhe gönnen.
Mit zusammengepressten Lippen entferne ich mich vom Schulgelände, hebe die Schultern und marschiere den mir vertrauten Weg entlang. Zurück in die Hölle.
Home sweet home!
••
Manche Leute bezeichnen ihr Zuhause als den schönsten Ort auf Erden. Für mich ist es genau das Gegenteil. Ich mag meine Familie nicht. Besser gesagt: Ich hasse sie.
Der Grund dafür ist meiner Meinung nach sehr plausibel.
Jeder glaubt, dass die vorbildliche Musterschülerin aus der Dirkenstraße mit dem hübschen, weißen Haus und der ebenfalls perfekten Familie eigentlich ihr Leben in vollen Zügen genießen müsste, weshalb die Jugendlichen in ihrem Neid oder Missverstehen mich noch mehr ignorieren oder eben beleidigen.
Doch sie liegen falsch.
Es ist wahr, dass wir sehr wohlhabend sind, aber der äußere Schein, der strahlende Glanz, trügt. Das eingefrorene Lächeln, die routinierten Höflichkeitsfloskeln und der eindrucksvolle Auftritt sind nichts weiter als Firnisse, die die Wahrheit überdecken. Und das sehr erfolgreich.
Es ist leicht, durch den Schein zu täuschen. Bei den Außenstehenden erwecken wir durch unser trügerisches Bild einen makellosen Eindruck, auf den meine Eltern sehr stolz sind. Sie wollen einen guten Ruf, eine perfekte Familie, ein hohes Ansehen.
Und natürlich zwei superschlaue Töchter, mit denen sie prahlen können.
Neben mir gibt es noch Lydia, meine ältere Schwester, die von meiner Mutter mehr geliebt wird als ich. Ich bin sozusagen das schwarze Schaf, eine andersdenkende Person, wenn man so will.
Lydia kann man schon beinahe als das Ebenbild von Mama bezeichnen. Sie sehen sich beide erschreckend ähnlich, verstehen sich wunderbar miteinander, weil meine ältere Schwester der ganze Stolz von Mama ist und haben beide ein kaltes Herz.
Meine Mutter ist ein Workaholic: Streng, ehrgeizig, hinterlistig und ohne viel Feingefühl. Während meine arrogante, überhebliche Schwester von ihr nur Lob zu hören bekommt, darf ich mich mit dem spöttischen Tadel und der grimmigen Kritik von Mama begnügen.
Nun, sie liebt mich eben nicht. Nicht sehr.
Ich gebe zu, dass es nicht sehr einfach ist. Man steht unter Druck, die Last auf den Schultern wird immer schwerer, die Erwartungen höher. Es kommt oft vor, dass ich abends im Bett liege und mich in ein anderes Leben wünsche.
Ohne tyrannische Eltern.
Seufzend schließe ich die Haustür auf und trete ein.
Es ist sehr still, für andere vielleicht schon ein wenig beängstigend, doch ich bin diese Geräuschlosigkeit gewohnt, wenn ich nach Hause komme.
Ich streife mir die Jacke ab, ziehe meine Schuhe aus und gehe dann langsam die blankpolierte Treppe nach oben. Automatisch sucht meine Hand das Geländer, denn jedes Mal habe ich Angst, auf diesen glatten Steinstufen auszurutschen.
Das Telefon klingelt, doch ich gehe nicht ran. Es wird sowieso kein Anrufer für mich sein, bestimmt nur für meinen Vater.
Papa ist nicht sehr viel anders als Mama, nur nicht so dominant und laut. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich ihn das letzte Mal lachen gesehen habe. Und damit meine ich, ein ehrliches, herzhaftes Lachen. Nicht diese falschen, viel zu übertrieben Laute, welche schon beinahe spöttisch klingen. Papa ist ein mürrischer Mensch, der schnell gestresst ist und immer seine Ruhe braucht.
Doch wenn sehr wichtige Personen zu Besuch bei uns sind, dann mutiert er urplötzlich zu einem gastfreundlichen, charismatischen Menschen - genau wie Mama, die in solch einem Moment die geliebte, glückliche Ehefrau spielen darf.
Sie wirken auf mich beide wie böse Maschinen, ohne Herz, ohne Seele. Manchmal frage ich mich, ob ich wirklich ein gewolltes Kind bin. Ob sie mich überhaupt lieben.
Ich weiß es nicht.
Aber ich glaube, dass dem nicht so ist.
Ich fühle mich oft fehl am Platz und habe das Gefühl, durch meine „andere“ Denkweise in meiner Familie nicht dazuzugehören.
Ich bin sehr gut in der Schule, eine Streberin würde man zu mir sagen, der Lehrerliebling eben. Doch das ist auch schon das einzige, was mich mit meiner Familie verbindet. Ansonsten kann ich ihre Meinungen und Einstellungen nicht teilen.
Meine Familie ist kein sicherer Hafen für mich.
Und das schlimme: Bei meinen Freunden sieht das nicht anders aus. Eigentlich zähle ich nicht viele Leute zu meinen Vertrauten, genau genommen: Niemanden.
Diese Tatsache habe ich schon immer gehasst.
Am Anfang habe ich noch versucht, mich mit anderen anzufreunden. Doch sobald es dann geklappt hat, haben mir meine Eltern wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht, nachdem meine mühsam neugewonnenen Freunde das erste Mal bei uns zu Besuch waren. Mama und Papa fanden sie einfach nicht anständig oder gut erzogen genug. Also durfte ich mich dann auch nicht mit ihnen verabreden. So lautet das stille Familiengesetz.
Und genau deshalb habe ich beschlossen, die Suche aufzugeben. Es würde so oder so nichts bringen, außer weitere Blamagen und Enttäuschungen. Nein, danke. Diese Erfahrung hat mich vorsichtiger gemacht.
– Und dann kam der Umzug, der alles nur noch verschlimmerte.
In den Sommerferien, dieses Jahres, bin ich mit meiner Familie in das kleine, beschauliche Städtchen in Niedersachsen gezogen, damit Mama dem neuen Beruf als Innenarchitektin und mein Vater dem Wunsch eine eigene Anwaltskanzlei zu eröffnen, nachgehen können. Es ist ein neuer Beginn für uns, ein Neustart, um sich von alten Problemen zu lösen.
Doch bei mir entwickelten sie sich dadurch erst recht.
Von Anfang an wurde ich als Freak abgestempelt, obwohl ich eigentlich ganz normal bin. Vielleicht ein wenig introvertiert, aber das sind doch viele, oder etwa nicht? Jedenfalls treffe ich hier in der Kleinstadt nur auf unsympathische Leute, die von vornherein große Ablehnung gegenüber mir zeigen.
Bin ich wirklich so schlimm?
Es ist, als hätten die Jugendlichen in meinem Alter eine Vereinbarung getroffen. Ich finde keinen Anschluss, muss akzeptieren, dass ich in meinen neuen Kursen nicht willkommen bin und nur auf Ignoranz stoße.
Ja, es ist schrecklich. Schrecklicher als in meinem Heimatort.
Dort hat man mich wenigstens noch akzeptiert, mich in Ruhe gelassen und man durfte die Hausaufgaben von mir abschreiben.
Doch hier?
Alles hat sich mit einem Schlag geändert, ich wurde zum Opfer. Währenddessen erfreuen sich meine Eltern an dem neuen Lebensabschnitt, genießen ihn und sind glücklich und zufrieden, denn ein langersehnter Traum ist für sie in Erfüllung gegangen.
Ich fühle mich allein. Es ist aussichtslos.
Deswegen habe ich beschlossen meiner Existenz ein Ende zu setzen.
In 21 Tagen, dann werde ich nämlich 17 Jahre alt. Alt genug, um zu sterben, wie ich finde. Ich bin mir der Tatsache vollkommen bewusst, dass ich bald nicht mehr leben werde. Und ich verspüre keine zweifelnden Gedanken deswegen. Es ist meine einzige Lösung. Auch wenn sie für andere Leute falsch klingen mag.
Ich will es.
Damit ich den Überblick über den Countdown nicht verliere, habe ich beschlossen, jeden Tag eine Skizze in meinem Notizblock zu malen. Eine Art Beschäftigungstherapie, wenn man so will.
Und heute ist der Zeitpunkt gekommen, um die erste Zeichnung, das erste Bild zu gestalten. Eigentlich wäre dies ein Grund zu feiern. Aber ich bin mir sicher, dass nicht viele Leute meine Freude darüber teilen würden und regelrecht entsetzt wären.
Nun, sie verstehen mich eben nicht.
Niemand tut es.
Meine Familie ist für mich keine Familie. Sie sind einfach ein paar Verwandte von mir, die dafür sorgen, dass ich gut in der Schule bin und später einen großartigen Abschluss habe.
Aber es gibt kein später. Nie mehr.
Die Entscheidung ist gefallen, ich werde sie nicht ändern.
Ich bin eine Verliererin, ein Opfer. Im Himmel, oder wo auch immer ich landen werde, wird es mit Sicherheit erträglicher sein. Alles. Nichts.
Ich verliere.
_________________
Ich weiß, dass der Anfang nicht sehr spannend ist, aber ich wollte erst einmal die Beweggründe von Leona erklären, wieso sie überhaupt Selbstmord begehen will. Ich hoffe, ihr findet das Thema nicht zu dramatisch oder skurril. :-)
LG
Teil 1 Teil 2 Teil 3 Teil 4 Teil 5 Teil 6 Teil 7 Teil 8 Teil 9 Teil 10 Teil 11 Teil 12 Teil 13 Teil 14 Teil 15 Teil 16 Teil 17 Teil 18 Teil 19
© rockundliebe.de - Impressum Datenschutz