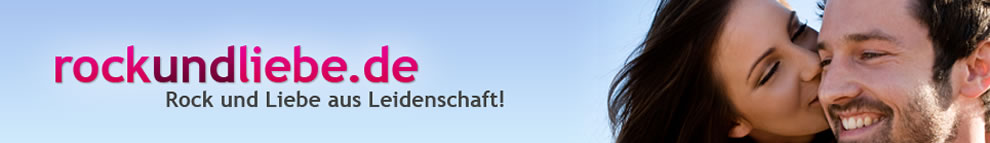
Die Nacht, in der ich nicht schlafen konnte - Teil 11
Autor: sunny
veröffentlicht am: 25.10.2011
Okay, Kapitel elf ist fertig! Hat doch länger gedauert, als ich dachte, weil ich doch ein wenig am Inhalt hin und her geknobelt habe; im Endeffekt ist es aber bei meiner ersten Idee geblieben :)
Viel Spaß damit und lasst mir ein paar Kommis da! <3
***
Kapitel elf
Back to black
Um zehn nach vier sitze ich noch immer hier, starre abwechselnd auf das Sofa und den Wecker in meiner Hand, dessen Zeiger sich einfach nicht schneller bewegen wollen.
Ich weiß nicht einmal, worauf ich warte. Ich warte einfach.
Warte… und warte… und warte…
Noch immer steht das Sofa unberührt da. Ich schließe die Augen, schließe sie ganz fest, und lausche und wünsche mir…
Wünsche mir Jack.
Und da kann ich ihn sehen, für einen Sekundenbruchteil sehe ich ihn so deutlich, wie ich nie zuvor… nie zuvor… etwas gesehen habe… das nicht da war.
Denn das ist er nicht.
Ich reiße die Augen auf, als ich ihn so deutlich sehe, und da steht immer noch das Sofa – ohne Jack. Da weiß ich, dass er natürlich nicht da war.
So eine frustrierende Erkenntnis.
Dabei hab ich wirklich gesehen, so deutlich, als sei er da – als sei er WIRKLICH da… alles hab ich gesehen. Genau, wie er Sonntag dort lag. Wie er sich aufgerichtet hat und mich angesehen; mit seinen Augen. Mit diesen Augen. Diesen Augen, seine Augen…
Ich kann nicht oft genug daran denken. Ich kann mich nicht oft genug daran erinnern, und doch ist jedes eine Mal ein Mal zu viel.
Jacks Augen…
Ich denke, dass es absolut schwachsinnig ist, wie sehr ich mich nach ihm verzehre; irgendwie schon richtig u n g e s u n d! Aber ich kann es nicht ändern. Ganz egal, wie sehr ich es auch versucht habe: Es hat sich nichts geändert.
Daher bin ich mir ziemlich sicher, dass sich auch nichts daran ändern w i r d.
Mir wird bewusst, dass ich bereits aufgegeben habe, und das macht mich erneut wütend. Wütend auf mich selbst; hallo??? Monster??? Reiß dich, verdammt nochmal, zusammen!!! Du warst doch immer stark. Du warst dein ganzes verdammtes Leben lang stark, also gib jetzt gefälligst nicht so einfach auf!!!
Aber ich erinnere mich an Jacks Augen, und allein diese Erinnerung löst Empfindungen in mir aus, die ich beim besten Willen nicht kontrollieren kann; also ist es wohl der einfachere und, nebenbei gesagt, wahrscheinlich auch der vernünftigere Weg, aufzugeben.
Vernünftig.
Bah. Das Wort schmeckt bitter. Ich schüttle mich. Vernunft… ist immer mit Vorsicht zu genießen. Hätte irgendwer in meinem Leben jemals v e r n ü n f t i g gehandelt, wäre ich mit großer Wahrscheinlichkeit nicht hier… aber ich hätte auch viele positive Erfahrungen niemals so gemacht.
Ich vermag nicht zu sagen, was besser ist – das IST oder das WÄRE. Ich weiß bloß, dass ich nichts bereue und nicht zurück will zum Ausgangspunkt. Ich bin froh, dass ich bin, wo ich heute bin. Auch, wenn ich die Zeit am liebsten am letzten Sonntag angehalten hätte…
Nachdem Susan und Jockel endlich das Zimmer verlassen hatten, saß ich da und starrte fassungslos auf das Foto – immer noch. Genau genommen starrte ich nicht einmal auf das Foto, sondern auf seine R ü c k s e i t e – da, wo tatsächlich etwas stand, genau wie Jockel gesagt hatte.
Mir war aufgefallen, dass ich bisher tatsächlich nicht ein einziges Mal die Rückseite dieses Fotos betrachtet hatte; wozu auch? Was mich überraschte, war, dass ich es nicht früher zufällig entdeckt hatte. Wahrscheinlich lag es daran, dass ich es bloß eingepackt und nicht einmal selbst wieder heraus genommen hatte; Susan oder Niki mussten es mit Tesafilm dort befestigt haben, wo es gehangen hatte (über dem Schreibtisch). Vermutlich deshalb, weil es das einzige Foto war, das sich in meinem Gepäck befand, mein einziges Foto überhaupt, alles, was dem Zimmer irgendwie etwas Persönliches geben konnte. Schon traurig, wenn ich so darüber nachdachte. Aber hätte ich denn Bilder meiner Mutter oder meines Bruders gewollt?
Höchstwahrscheinlich nicht.
D i e s e s Foto hingegen wollte ich. Ich verband positive Emotionen damit. Und der Text auf seiner Rückseite… tja… ich hatte damit ganz bestimmt nicht gerechnet.
Es war nur ein Satz, ein einziger Satz, in Frau Lehmanns vertrauter, geschwungener Handschrift geschrieben. Sie hatte noch diese leicht schnörkelige Schrift von alten Leuten, die mir bei ihren Einkaufszetteln manchmal Probleme bereitet hatte; es hatte eine Weile gedauert, ehe ich einwandfrei entziffern konnte, was sie mir mit ihren Schleifchen und Kringeln mitteilen wollte.
Zu der Zeit jedenfalls konnte ich es problemlos lesen.
Es war mit Füller geschrieben, eine feine Mine, die sie immer benutzte; und mit schwarzer Tinte, die sie ebenfalls bevorzugt benutzt hatte, solange ich mich erinnern konnte.
Ein Satz.
Ein einzelner Satz, der mich dermaßen aus der Fassung brachte…
„Falls du beschließen solltest, dich zu wehren“, stand da, „Schau beim Teeservice nach.“
Das war alles.
Nichts weiter, kein Gruß, keine Erklärung, nicht einmal eine Anrede; und dennoch machte es mich so betroffen, denn ich wusste genau, dass Frau Lehmann es geschrieben hatte, ich wusste genau, dass es an mich gerichtet war, und ich wusste auch genau, welches Teeservice sie meinte. Was ich nicht genau wusste, war, w a r u m ich dort nachsehen sollte.
„Falls du beschließen solltest, dich zu wehren“… Mein Hirn lief auf Hochtouren, während ich nachdachte, mich zurückerinnerte.
Frau Lehmann hatte mich mehr als einmal auf meine… Situation zuhause angesprochen.
Weil ich aber jedes Mal sofort abgeblockt hatte, hatte sie auch nicht weiter gefragt. Ich war ihr ziemlich dankbar dafür, dass sie mich selbst entscheiden ließ, wie ich mit der Situation umgehen sollte.
Sie hatte entscheidend dazu beigetragen, dass ich den Schritt wagte, von zuhause fort zu gehen; Immer wieder hatte sie betont, dass nichts so bleiben müsse, wie es war. Auch, als ich ihr den Entschluss mitgeteilt hatte, dass ich fortgehen würde, hatte sie durchweg positiv reagiert. Und trotzdem.
Was hatte sie bloß bei ihrem Teeservice versteckt? Und warum, um Himmels Willen, hatte sie es mir nicht einfach gegeben???
Weil sie wollte, dass ich es bewusst fand, klar. Irgendwie war das typisch Frau Lehmann; Mich zu zwingen, mich b e w u s s t für etwas zu entscheiden, anstatt es mir leicht zu machen. Sie wollte, dass ich es auch wirklich wollte, dass ich es nicht bloß aus einem Impuls heraus tat oder weil ich das Gefühl hatte, dass jeder es von mir erwartete. Das zumindest war die einzige Erklärung, die mir einfiel; und ich muss sagen, sie passte auch perfekt ins Bild.
Ach, Frau Lehmann…
Ein leicht wehmütiges Lächeln glitt über meine Lippen. Liebe, gute Frau Lehmann…
Obwohl sie mich immer aufgefordert hatte, etwas zu unternehmen, mich zu wehren oder zu gehen, war sie doch auch einer der triftigsten Gründe, weshalb ich so lange geblieben war.
Lange saß ich nur da und starrte, unterbrochen von einigen Husten- oder Niesanfällen, das Foto an. Ich wusste kaum, was ich denken sollte; und noch viel weniger wollte mir einfallen, was um Himmels Willen ich jetzt tun sollte.
Schließlich wusste ich nur eins, und das war, dass ich hier raus musste.
Ich ertrug es hier drinnen schlichtweg nicht länger, es engte mich alles so ein und ich konnte keinen klaren Gedanken fassen, zu lange hatte ich schon hier drinnen fest gesessen. Und Krankheit hin oder her, ich brauchte jetzt frische Luft.
Also zog ich mich ordentlich an und steckte meinen Schlüssel und das Foto ein.
Und weil ich auf Susans permanentes Geplapper jetzt wirklich beim besten Willen keine Lust hatte, lotete ich vorsichtig die Lage aus (alles ruhig auf dem Flur, also waren Susan und Jockel mit großer Wahrscheinlichkeit nicht da) und schlich dann auf Zehenspitzen aus meinem Zimmer.
Weil es am Ende des Flures lag, musste ich an allen Zimmern bis auf Lars‘, das auf der anderen Seite lag, vorbei, aber glücklicherweise kannte ich mich mittlerweile gut genug aus, um knarrende Dielenbretter zu vermeiden und leise bis zur Wohnungstür zu kommen. Ich hoffte und betete, dass niemand in der Küche war und dass auch keiner aus dem Bad kommen würde, während ich hier entlang schlich; aber wie es aussah, war das Glück mir hold. Ich konnte ungesehen meine Schuhe schnappen und rasch aus der Wohnungstür flüchten. Aufatmend lehnte ich mich an die Wand des Treppenhauses und beruhigte mich erst einmal wieder, bevor ich in der Lage war, mir die Schuhe anzuziehen und die Treppen hinunter zu laufen. Meine Schritte waren hastig, doch ich schaffte es, nicht hinzufallen. Mit einer entschlossenen Bewegung öffnete ich die Haustür – und stand Ben gegenüber.
Erst sah er mich nur irritiert an, dann holte er Luft, um etwas zu sagen, schloss den Mund aber doch wieder. Mit abwartender Miene schob er die Hände in die Hosentaschen.
„Äh… ich… wollte nur… muss noch…“, stotterte ich.
Ben verschränkte die Arme vor der Brust und legte den Kopf schief. „Du bist krank“, merkte er an, „Du musst gar nichts, nur gesund werden.“
Panisch flatterten meine Hände durch die Luft, in dem hektischen Versuch, ihm etwas zu erklären, das ich selbst noch nicht in Worte fassen konnte. „Aber ich kann nicht denken! Ich kann nicht denken da drin! Und das Foto… ich muss doch nachsehen, was… und ob… und ich kann doch nicht…“
„Monster, beruhige dich“, unterbrach Ben mich mit seiner ruhigen Samtstimme, dieser völlig gelassenen Art, die mich schon am ersten Tag so fasziniert hatte. Ich hielt inne, ließ die Hände sinken und starrte ihn mit großen Augen an. „Ich muss zurück“, stellte ich flüsternd fest. „Aber ich kann doch nicht… einfach… was ist, wenn…“ Verbissen kniff ich die Lippen zusammen, wandte den Blick ab. Ich sehnte mich nach Jack. Oh, wie sehnte ich mich nach Jack! Es tat beinahe körperlich weh… ich wusste, wäre er da gewesen, er hätte Worte für die Situation gefunden, genau die richtigen Worte; ich war überzeugt davon, dass Jack in der Lage gewesen wäre, alles in Ordnung zu bringen, alles wieder gut zu machen, eine Lösung für alles zu finden.
Aber Jack war nicht da. Jack war weit fort bei seiner Familie.
Und vor mir stand Ben und sah mich forschend an.
Ich wusste, ich musste eine Entscheidung fällen. Nur welche – welche? Würde ich mich entscheiden, hier zu bleiben, einfach umzukehren und mich in die WG zurückzuziehen, würde ich mit ziemlicher Sicherheit an der Ungewissheit vergehen; vor lauter Unruhe würde ich es kaum aushalten.
Was aber, wenn ich tatsächlich beschlösse, nach Hause zurückzukehren, um Frau Lehmann nach den Worten auf dem Foto zu fragen und beim Teeservice nachzusehen, was sie dort lagerte?
Tja… ich wusste, damit würde ich mich sozusagen in die Höhle des Löwen wagen, geradewegs zurück in das Elend, dem ich so verzweifelt zu entkommen versucht hatte.
„Willst du reden, Monster?“, fragte Ben sanft.
Reden? Ich sah ihn an, in sein freundliches Lächeln, und ich wusste, reden wollte ich nicht. Wäre er Jack gewesen – vielleicht. Wäre Jack hier gewesen… dann wäre ohnehin alles anders. Aber Jack war nun mal nicht hier. Vor mir stand Ben, der mich immer noch fragend ansah und geduldig auf eine Antwort wartete.
Reden.
Nein, reden wollte ich nicht… ich wollte handeln.
Aufgeregt sah ich Ben an. „Ben, du hast doch ein Auto, oder?“
Langsam, sichtlich irritiert nickte er. „Äh, ja…“
„Könntest du… würdest du…“
Nein, ich konnte nicht allein fahren. Ich konnte unmöglich allein dorthin zurück… oder?
„Würdest du… kannst du…“
Ben zog die Augenbrauen hoch. „Dich irgendwohin fahren?“
Unbehaglich zog ich die Schultern hoch. „Ich… ich weiß, ich hab eigentlich den Führerschein… aber ich…“
„Hey.“ Ben lächelte. „Ist schon okay. Ich fahr dich gern, du bist schließlich krank. Aber wo, um Himmels Willen, willst du denn in deinem Zustand hin?!“
„Ich…“ Ich zögerte. Sollte ich wirklich…?
Aber ich musste. Ich konnte einfach nicht anders.
„Ich muss da etwas klären. Dringend. Aber es ist… ziemlich weit…“ Unsicher sah ich ihn an.
„Wie weit?“, fragte Ben misstrauisch.
Leise nannte ich ihm die Adresse. „Ich weiß, es wird lange dauern, wir werden die halbe Nacht unterwegs sein, aber ich kann einfach nicht allein dorthin, und ich hab kein Auto, und ich… ich meine, es ist echt wichtig… Es ist w i r k l i c h wichtig…“
„Du willst nach Hause“, unterbrach Ben mich nachdenklich. Als ich erschrocken aufsah, setzte er erklärend hinzu: „Da kommt ihr doch her, du und Susan.“
Ich nickte langsam. „Ja, da komme ich her…“ Kurz zögerte ich, „Aber es ist nicht mein Zuhause.“ Die Worte klangen entschieden.
Ben fragte nicht nach. Er sah mich bloß lange an, zückte seinen Autoschlüssel und verkündete: „Okay. Gehen wir.“
Ohne ein weiteres Wort drehte er sich um und lief den Plattenweg vor dem Haus zurück zur Straße.
Überrascht folgte ich ihm.
Bens Auto war ein kleiner Gebrauchtwagen, keine Ahnung, was für einer genau, mit Autos kenne ich mich nun wirklich nicht aus. Die Rückbank des Wagens war mit allem möglichen Zeug belagert, Ben und ich saßen vorn, in stillem Einvernehmen nebeneinander, und starrten durch die Windschutzscheibe nach draußen; ich weiß nicht, wie viele Stunden lang. Das Radio lief, nach einer gewissen Zeit schienen sich die Songs nur noch zu wiederholen, von Zeit zu Zeit quatschte Bens Navigationsgerät mit nervtötender Stimme dazwischen. Wir schwiegen. Ich war noch immer zutiefst verwirrt von allem, was an diesem Tag geschehen war, ich sehnte mich nach Jack – es kam mir vor, mehr als je zuvor – der es doch bisher immer geschafft hatte, Licht ins Dunkel meiner wirren Problemwelten zu bringen. Ich sehnte mich danach, mich bei ihm anzulehnen, einfach bei ihm zu sein, mit ihm zu schweigen.
Stattdessen saß ich hier und schwieg neben Ben her, was nun wirklich etwas ganz und gar anderes war.
Ja, ich war froh, jemanden zu haben, nicht gänzlich allein zu sein in dieser Situation; aber ich hatte so große Angst vor dem, was kommen könnte, dass ich wusste, Ben war nicht gut genug. Natürlich war er ein Freund; ein ziemlich guter, soweit ich das beurteilen kann. Natürlich war er mir eine Hilfe; natürlich meinte er alles nur gut… aber: Er war eben nicht Jack. Egal, was Ben auch tat, er würde immer Ben bleiben.
Irgendwann, als ich schon längst das Zeitgefühl verloren hatte – inzwischen war es draußen dunkel geworden und wir rollten durch eine von Lichtern gespickte Nacht – stellte Ben das Radio leiser und begann zu sprechen.
„Monster… du musst mir natürlich nichts erzählen; aber… ich bin schon neugierig, was so wichtig ist, dass du Hals über Kopf nach… in deine Heimatstadt willst. Und wie lange du dort bleiben willst. Ich muss zwar morgen nicht arbeiten, aber… es wäre trotzdem hilfreich zu wissen… wann wir wieder da sind.“
Er warf mir einen vorsichtigen Blick zu.
„Ich denke nicht, dass es lang dauern wird“, erklärte ich leise. „Ich muss nur… etwas klären. Jemanden etwas fragen.“
„Deine Familie?“, fragte Ben leise nach einer Weile des Schweigens.
Ich schüttelte bloß den Kopf. Ich hatte keine Lust, zu reden. Keine Lust, schon wieder meine Vergangenheit… meine ganze Unsicherheit und Verwirrung vor jemandem auszubreiten… schon gar nicht vor jemandem, der nicht Jack war.
Leicht ärgerlich wurde ich mir bewusst, dass ich Jack schon längst viel mehr vermisste als geplant. Das hier war nicht gut. Gar nicht gut. Ich war bereits viel tiefer in eine Abhängigkeit gerutscht, als ich jemals gewollt hatte; und ich hasste es, abhängig zu sein. Dieses Gefühl machte mich so hilflos.
Verdammt nochmal, konnte ich denn keine einzige Entscheidung selbstständig treffen – ohne Jack?!? Ich musste doch wohl in der Lage sein, selbst zu wissen, was ich wollte und was gut für mich war!!
Tja… Jack war gut für mich.
Und das war das größte Problem an der Sache; dass nämlich irgendwie nichts anderes mehr zu helfen schien als Jack. Und dass Jack nunmal kein Talisman war, den ich in der Hosentasche mit mir herumtragen konnte. Jack war ein lebendiger Mensch. Eine eigenständige Persönlichkeit. Und ich konnte nicht von ihm verlangen, immer in meiner Nähe zu sein; auch, wenn mir das am liebsten gewesen wäre.
Irgendwann mitten in der finsteren Nacht hielt Ben auf einem Parkplatz nicht weit von meinem alten Zuhause entfernt. Ich war völlig fertig mit den Nerven – mit zittrigen, nass geschwitzten Händen versuchte ich, die Tür zu öffnen, bis Ben meine Versuche unterbrach, indem er sanft nach meiner Hand griff. Im ersten Moment zuckte ich zusammen.
„Monster“, sagte Ben leise, „Du musst da nicht raus, das weißt du. Wenn du das nicht willst, musste du überhaupt nirgendwohin gehen.“
Und genau das war es doch, was auch Frau Lehmann mir hatte sagen wollen: „Falls du beschließen solltest, dich zu wehren…“
Ja, falls. Nur f a l l s ich mich entschließen sollte, mich zu wehren…
Aber hatte ich das nicht längst?
Ach, tatsächlich?
War es nicht vielmehr so, dass jemand anderes es für mich entschieden hatte – wie immer? Mein Bruder, diesmal war es wieder mein Bruder gewesen. Mit seinem Anruf hatte er mich dazu gebracht, etwas zu unternehmen. Weil ich wusste, ich würde es nicht ertragen, NICHTS zu unternehmen; weil ich wusste, dass ich entweder in meine alte Opferrolle zurückfallen oder mich wehren musste. Weglaufen war nicht mehr. Dazu war es längst zu spät; ich hatte in Berlin längst Halt, Freunde, eine Heimat gefunden.
Und Jack. Nicht zu vergessen Jack.
„Doch“, entgegnete ich, und meine Stimme klang fest dieses Mal. Ich brachte es sogar fertig, Ben in die Augen zu sehen. „Ich muss das jetzt tun.“ Ich entzog ihm meine Hand, hielt aber kurz inne. „Könntest du… würdest du…“
„Ich komme mit dir“, unterbrach mich Ben, und noch bevor ich meine Überraschung überwinden konnte, war er ausgestiegen. Verdutzt kam ich ihm nach, schloss die Tür und sah ihn über das Dach des Autos hinweg an.
„Das musst du nicht tun“, belehrte ich ihn, „Du musst nicht mitkommen. Ich wollte dich nur bitten…“
Aber wieder ließ er mich gar nicht ausreden. „Was auch immer du vorhast“, vermutete er lächelnd, „Du tust es nicht gern. Du hast Angst, Monster. Ein Freund an deiner Seite kann da doch nicht falsch sein. Also werde ich dich begleiten.“
Mit einer Hand wies er mir, voraus zu gehen. „Zeigst du mir den Weg?“
Ich schluckte und musterte ihn unsicher. Dann nickte ich.
Und ging los.
Vor dem Block, in dem ich gewohnt hatte, lungerten wie immer einige Typen herum, die Sorte, mit denen mein Bruder engen Umgang gepflegt hatte, solange ich denken konnte. Immer stärker zitternd hielt ich auf den Hauseingang zu, möglichst ohne in ihre Richtung zu blicken. Aus dem Augenwinkel nahm ich trotzdem jede ihrer Bewegungen wahr, fixierte ihr Tun, als könnten sie mich jeden Moment attackieren. Wahrscheinlich könnten sie das auch. Und würden es, falls sie mich erkennen würden.. oder?
Oh, verdammt, verdammt, verdammt. Die Angst stieg immer mehr, je näher wir dem Haus kamen, bis ich kaum mehr einen Fuß vor den anderen setzen konnte. Worauf hatte ich mich da bloß eingelassen?
Bisher schien mich keiner der Anwesenden erkannt zu haben, mein Bruder war auf jeden Fall nicht dabei.
Trotzdem. Immer deutlicher wurde mir bewusst, was ich hier eigentlich zu tun im Begriff war. War ich eigentlich völlig bescheuert?! Ich begab mich auf direktem Wege in die Höhle des Löwen, schön auf dem Präsentierteller vor die Klauen meines rachsüchtigen Bruders, vor dem ich, wohlgemerkt, erst vor wenigen Wochen geflohen war – und wofür bitte?! Für einen Blick auf ein altes Teeservice? Das alles nur, um meine verdammte Neugier zu befriedigen?!
Ich war so kurz davor, einfach umzudrehen, kehrt zu machen und erneut zu fliehen, bevor etwas Schlimmeres geschehen konnte. So kurz.
Doch dann erinnerte ich mich daran, dass ich nicht allein hier war. Hinter mir ging Ben, der mich extra hergefahren hatte, Ben, der sich solche Mühe gab, Ben, der immer freundlich war. Ben, der jetzt Mut von mir erwartete.
Also holte ich noch einmal tief Luft und trat durch die kaputte Eingangstür ins Haus. Sie war noch immer nicht repariert worden – seit zwei, drei, vier ? Jahren nicht. Wahrscheinlich würde sie auch nie repariert werden.
Egal.
Das interessierte mich nicht.
Mit entschlossenen, aber dennoch wackligen Schritten nahm ich die Treppe in Angriff, umklammerte mit rechts das Geländer, während ich Stufe um Stufe hinaufstieg, immer Bens ruhige Schritte in meinem Rücken, die Gewissheit, nicht allein zu sein, das hier nicht ohne Hilfe meistern zu müssen.
Er war nicht Jack; aber immerhin war er da.
Allein diese Tatsache trug enorm zu meiner Beruhigung bei.
Auf unserem Stockwerk hielt ich schwer atmend inne. Nicht der Aufstieg hatte mich so sehr angestrengt – Treppensteigen war ich ja gewohnt –, sondern die Angst, die Unruhe und die Selbstbeherrschung, die es mich gekostet hatte, diese Schritte zu tun.
Kein Laut war zu hören aus einer der beiden Wohnungen, trotzdem lauschte ich angestrengt.
Nein. Nichts.
War niemand da?
Ich wagte es kaum zu hoffen. Frau Lehmann schlief vielleicht, aber bei uns… wenn mein Bruder da war, hörte er fast immer laute Musik, und bei meiner Mutter lief ständig der Fernseher. Noch einmal horchte ich aufmerksam – nichts.
Mit zitternden Fingern kramte ich den Schlüssel aus meiner Hosentasche, um es schnell hinter mich zu bringen. Ben stand still und geduldig an meiner Seite; ich fühlte mich unwohl, so unwohl dabei, ihn in dieses mein altes Leben zu lassen, weil es mir peinlich war, all die Armut zu sehen, und er hier schlichtweg nicht hin gehörte. Dennoch war er hier; und ich konnte nicht leugnen, dass ich es ohne ihn kaum so weit geschafft hätte.
Gerade näherte ich den Schlüssel der Wohnungstür, da waren auf einmal Schritte auf der Treppe zu hören. Das kalte Licht flackerte hektisch und unterbrach sein permanentes Summen für ein kurzes Knacken, bevor es wieder in seinen dahindämmernden Modus fiel.
Erstarrt hielt ich inne, drehte mich um und zog mich instinktiv in die hinterste Ecke des Treppenaufgangs zurück. Innerlich sprach ich leise Gebete, obwohl ich wirklich nie gläubig gewesen war.
*Bitte, bitte, lass es nicht mein Bruder sein. Bitte. Bitte, ich flehe dich an, lass nicht meinen Bruder hier rauf kommen… lass es nicht Johannes sein… bitte…*
Die Schritte auf der Treppe stockten, ich hörte geräuschvolles, angestrengtes Atmen. Ben stand längst mit aufmerksamem Gesichtsausdruck neben mir, als ich mich halbwegs entspannte.
Das war nicht Johannes. Dem Geräusch des Atems nach zu urteilen, handelte es sich bei der Person auf der Treppe um eine Frau; um keine allzu junge, wenn ich mich nicht irrte. Meine Mutter konnte es nicht sein. Sie ging doch nie raus; und wenn, würde sie sicher anders klingen… oder?
Langsam setzten die Schritte sich wieder in Bewegung, und kurz darauf erschien ein gesenkter Kopf in unserem Blickfeld, der sich bei jedem Schritt weiter hob.
Ja, es war eine Frau. Nicht meine Mutter.
*Gott sei Dank.*
Es Frau Schmidt, die zwei Stockwerke über uns wohnte. Frau Schmidt; eine von denen, die ihr Leben lang weggesehen und weggehört hatten. Sie hatte zwei Töchter, etwas jünger als ich. Sie hatte nie, nie etwas getan, obwohl ich mir relativ sicher war, dass sie etwas mitbekommen hatte; etwas mitbekommen haben musste. Wer hatte das denn bitte nicht? Das ganze Haus, der ganze Block hatte darüber getuschelt, wenn er glaubte, ich hörte ihn nicht… dabei hörte ich es. Ich hörte alles. All das, was ich nicht hören sollte… all das wertlose Geplapper zu feiger Menschen, gefangen im Gefängnis ihres steifen, eingestaubten Selbstbildes.
All die Worte.
Wie ich sie gehasst hatte.
Auf dem Treppenabsatz vor den Wohnungen, wo Ben und ich noch immer reglos standen, hielt Frau Schmidt inne, verschnaufte kurz (Sie trug in beiden Händen Einkaufstaschen) und setzte dann gemächlich ihren Weg fort, wobei sie instinktiv den Kopf hob.
Erschrocken hielt sie inne, als sie uns in der schwach beleuchteten Ecke entdeckte. Gleich darauf wandelte sich ihr Gesichtsausdruck zu einem der Überraschung, dann zu einem des Mitleids.
Mitleid! Auch das verabscheute ich… in ihren Augen… die doch immer bloß weggesehen hatten.
„Monster!“, sprach sie mich überrascht an. „Du bist ja wieder da…“ Ein merkwürdiges Gemisch aus verschiedenen Emotionen (Mitleid, Schuldbewusstsein, vielleicht Reue?) schwang in ihrer Stimme mit. Ich konnte es nicht ganz deuten.
Benommen nickte ich bloß. Was, wenn sie meiner Mutter und meinem Bruder davon erzählen würde…?
Aufseufzend stellte Frau Schmidt ihre scheinbar schweren Einkaufstaschen ab und trat einen Schritt auf mich zu. Sie streckte die Hand nach mir aus, aber ich wich ihr aus, worauf sie sie wieder sinken ließ und mich bloß mit diesem merkwürdigen Blick musterte.
„Du siehst blass aus, armes Kind… kein Wunder, bei dieser Tragödie… ihr armen Kinder… wie geht es deinem Bruder? Ich hab ihn schon seit… du weißt schon, wann… nicht mehr gesehen…“
Irritiert runzelte ich die Stirn, wovon bitte sprach sie da? Was für eine Tragödie?
„Was meinen Sie? Seit… seit wann?“
Vertraulich senkte sie ihren Kopf dem meinen entgegen.
„Du weißt schon… seit deine liebe Mutter… uns verlassen hat.“
Überrascht und verwirrt starrte ich sie an und konnte nur dümmlich wiederholen: „Verlassen?“
Noch näher kam ihr Gesicht, diesmal sah ich ganz deutlich das Mitleid darin, aber auch das Widerstreben, diese Worte zu mir zu sagen. „Nun, seit… ihrer Beerdigung, Kind. Es geht ihm doch wohl gut? Ihr haltet doch zusammen, ihr Geschwister, nicht wahr?“
Meinte sie das ernst?
Aber ich konnte nicht einmal ernsthaft darüber nachdenken, sondern starrte bloß fassungslos in ihr mitleiderfülltes Gesicht.
*Seit deine liebe Mutter uns verlassen hat. Seit ihrer Beerdigung, Kind.*
Wie ein höhnisches Echo hallten die Worte in meinem Kopf wieder.
Es war ein Schock.
Natürlich war es das.
Ich hatte meiner Mutter vielleicht nicht viele positive Erfahrungen zu verdanken; ich konnte mich an keine Zeit erinnern, in der ich mich auf sie hätte verlassen können. Sie hatte mich eher tyrannisiert als in irgendeiner Weise für mich gesorgt zu haben; und dennoch.
Trotz allem war und blieb sie meine Mutter. Meine Mutter, die einzige, die ich je gehabt hatte. Das war sie und das würde sie auch immer bleiben; und es tat verdammt weh, von ihrem Tod zu hören. Vielleicht auch, weil es so unheimlich unerwartet kam. Ich hatte gewusst, dass meine Mutter tablettenabhängig und eine hoffnungslose Alkoholikerin war. Ich hatte gewusst, dass es nicht gesund sein konnte, was sie ihrem Körper antat. Und trotzdem hatte ich nie im Leben mit ihrem T o d gerechnet! Tod… Tod, das klang so schrecklich, so endgültig.
Keuchend spürte ich, wie meine Beine nachgaben, hörte nur verschwommen Frau Schmidts aufgeregte Stimme – hatte sie wirklich nicht gewusst, dass ich ahnungslos war? Glaubte sie wirklich, dass mein Bruder mich beschützen würde? – und spürte Bens Hände, die mich stützten, mich auffingen und hielten. Zum wiederholten Mal war ich froh, nicht allein hier zu sein, diesen nicht enden wollendem Albtraum nicht allein bewältigen zu müssen. Und nicht zum ersten Mal wünschte ich mir Jack an meine Seite, so sehr, mit aller Macht. Jack, wo warst du bloß? Warum hast du mich bloß allein gelassen?
Ich wusste, Jack hätte mich verstanden, wäre er hier gewesen. Er hätte mir helfen können und wie immer die richtigen Worte gefunden.
Aber Jack war nicht hier.
Noch immer nicht.
Einige Minuten später saß ich zittrig auf dem kalten Boden des Treppenabsatzes, Ben neben mir, Frau Schmidt mit besorgtem Gesichtsausdruck mir gegenüber.
„Wann?“, fragte ich, als ich das Gefühl hatte, meine Stimme müsse nicht mehr jeden Augenblick brechen. „Wann… wann war das? Wann ist sie…“ Ich schluckte, sammelte mich und brachte den Satz stockend zu Ende. „…gestorben?“
„Lieber Herr im Himmel, Kindchen“, flüsterte Frau Schmidt mit großen Augen, „Weißt du das wirklich noch nicht? Das war vor einer Woche… ja, Donnerstag. Heute vor einer Woche.“ Sie dachte kurz nach. „Die Beerdigung war am Sonntag.“
Sonntag.
Wie kalter Regen flossen die Worte meinen Rücken hinunter, ich schauderte.
Sonntag.
Sonntag, das war der Tag, an dem Johannes mich angerufen hatte… das war der Tag… Jener Regentag…
Sonntag.
Ich konnte es nicht fassen.
Wieder und wieder wiederholte ich das Wort in Gedanken. Sonntag. Sonntag. Sonntag, Sonntag, Sonntag.
Längst hatte ich den Rest der Welt ausgeblendet und hörte nicht mehr, was Frau Schmidt und Ben zu mir sagten.
Ich war wie taub.
Sonntag.
Es war Sonntag gewesen… und Johannes hatte kein Wort davon gesagt.
Nur gedroht hatte er mir.
Angst hatte er mir gemacht.
Am Sonntag.
Schaudernd zog ich die Beine eng an meinen Körper, schlang die Arme darum und starrte blicklos ins Leere.
*Jack.
Jack, wo bist du?
Jack, warum bist du nicht hier?
Warum kommst du nicht und tröstest mich?
Du könntest es doch.
Ich weiß, dass du es könntest.
Und nur du. Niemand anders kann das so wie du.
Bitte, Jack. Lass mich nicht allein. Bitte.
Bitte komm doch her und hilf mir…*
Langsam begann ich, vor und zurück zu schaukeln.
Ich spürte kaum noch Bens warme Hände, die unermüdlich versuchten, mich zu halten und zu trösten.
Ich spürte nur noch die Kälte.
*Jack… bitte.*
Teil 1 Teil 2 Teil 3 Teil 4 Teil 5 Teil 6 Teil 7 Teil 8 Teil 9 Teil 10 Teil 11 Teil 12 Teil 13 Teil 14
© rockundliebe.de - Impressum Datenschutz