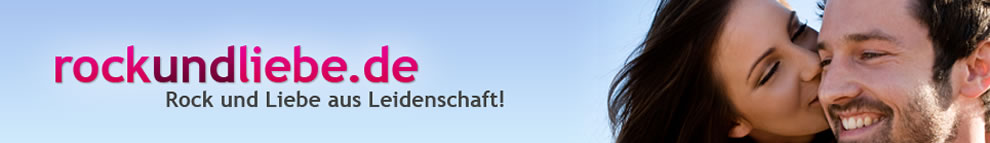
Tochter der Finsternis - Teil 3
Autor: Sundown
veröffentlicht am: 02.09.2013
„Ich mach mich auf den nach Hause weg“, sagte Joshua, nachdem sie in den Flur hinausgetreten waren und die Küchentür hinter ihnen ins Schloss gefallen war . „Meine Mum wartet sicher schon auf mich und es gibt noch einige Dinge, bei denen ich ihr gerne helfen würde. Sehen wir uns heute Abend?“, wollte er wissen und fuhr Mia liebevoll über ihre rosigen Wangen.
„Natürlich.“ Sie lächelte ihn an und zögerte einen Moment, dann fragte sie: „Wie geht es dir? Ich weiß, dass dich die Krankheit deiner Mutter sehr belastet, aber du redest nie darüber. Manchmal mache ich mir Sorgen, ob du das nicht irgendwie alles in dich hineinfrisst. Du weißt, dass du da nicht alleine durch musst, oder? Ich steh an deiner Seite - egal was ist. Du kannst mit mir reden, so oft und so lange du möchtest. Ich versuche dir so gut es geht bei allem zu helfen. Ich…“
„Ich weiß“, unterbrach er sie schroff. Einen Moment wirkte er gestresst, genervt. Doch dann fing er sich wieder und versuchte ein Lächeln zustande zu bekommen. „Es ist nicht leicht. Ich rechne jeden Tag damit, dass sie gar nicht mehr alleine aufstehen kann. Es ist ein enormer Druck. Es gibt keinen Moment, indem ich nicht an sie denke. In der Zeit, in der mein Vater weg war und noch weg ist, traue ich mich nicht einmal nachts einzuschlafen, aus Angst, ich würde nicht erwachen, wenn meine Mum nach Hilfe schreit, falls irgendetwas passiert…“ Er stockte. Dann fuhr er fort: „Es ist hart, aber ich werde das überstehen. Darüber zu reden, macht es meistens nur noch schlimmer. Ich weiß, dass du für mich da sein willst, ich weiß, dass du mir nur helfen willst. Und das tust du, indem du einfach hier bist, an meiner Seite und mich so behandelst, als wäre die Welt in Ordnung. Ich könnte es nicht ertragen, ständig mitleidige Blicke von dir zu ernten und von dir bemuttert zu werden, als wäre ich selbst der Patient. Ich brauche dich als meine Freundin. Ich kann nicht mit dir darüber reden - ich weiß, das klingt in deinen Ohren schrecklich. Aber es ist nicht so, dass es an dir liegen würde. Ich…“ Er klang zu verzweifelt, sodass Mia ihn sanft unterbrach und sein Gesicht zwischen ihre Hände nahm, sodass er gezwungen war, ihr in die Augen zu schauen. „Ist schon in Ordnung, Josh. Ich verstehe dich. Natürlich verstehe dich nicht. Und wenn du nicht darüber sprechen kannst oder willst - dann ist das nichts, was ich nicht akzeptieren würde. Wenn einfach bei dir zu sein und das Thema zu meiden das ist, was dir hilft, dann ist das vollkommen in Ordnung. Mach dir da nicht so viele Gedanken.“ Sie drückte ihn einen zärtlichen Kuss auf die Lippen und ließ ihn schließlich los.
„Danke“, erwiderte er und strich ihr über das Haar. „Ich hol dich bei Anbruch der Nacht ab.“ Mit diesen Worten wandte er sich ab und verließ das Haus.
Mia selbst ging nach oben in ihr Zimmer, schloss hinter sich die Tür und warf sich auf das Bett, um noch ein paar Stunden zu schlafen.
Es war bereits Dunkel. Die Sonne war vor einer guten halben Stunde als orangefarbenen Feuerball hinter den weit entfernten Bergen im Westen verschwunden und hatte die Mittagswärme mit sich genommen. Ein eisiger Wind fuhr durch die schmalen Gassen des Dorfes und wirbelte Staubkörner mit sich. Die Wege waren leer, die Menschen hatten sich in die schützenden Wände ihres zu Hauses zurückgezogen, die Tiere suchten die Zuflucht in den Wäldern.
Stille.
Mia stand in ihrem Zimmer, eine Decke um die Schultern gezogen und starrte aus dem Fenster. Joshua hätte sie schon längst abholen sollen. Es war nicht seine Art sich zu verspäten und daher machte sie sich tierische Sorgen. Bibbernd zog sie den Kopf zwischen die Schultern und lehnte sich weiter nach vorne, um einen besseren Blick auf den Weg, der unter ihrem Fenster entlang zur Haustür führte, zu ergattern. Doch weit und breit war kein Joshua in Sicht. Nervös knabberte sie auf ihren Lippen herum. Als sie nicht mehr ruhig stehen konnte, tigerte sie auf und ab. Wartend, verzweifelt, unruhig. Als sie die Stille und Leere um sich herum nicht mehr aushielt, zog sie sich rasch ein paar Schuhe über, huschte zur Tür, lauschte und öffnete sie schließlich langsam. Dem Geräuschpegel nach zu urteilen mussten ihre Eltern bereits im Schlafzimmer verschwunden sein, also tappte sie leise zur Treppe, schlich hinunter bis hin zur Haustür und verschwand schließlich nach draußen. Dort empfing sie mit eisigen Armen der immer heftiger werdende Wind, der sie umhüllte, sodass sie anfing am ganzen Körper zu zittern. Mit schnellen Schritten lief sie los, immer den Weg folgend auf den Rand des Dorfes zu, dort wo Joshua und seine Familie lebte.
Es war düster. Die Straßen wurden nur durch die schwachen Lichter, die aus den Fenstern der Häuser strömten, leicht beleuchtet. Fensterläden klapperten, ein Kauz schrie in der Nähe, die letzten Nager huschten von dem ungeschützten Hauptweg in die noch dunkleren Gassen. Mia erschauderte. Doch diesmal nicht vor Kälte, sondern vor Furcht. Es lag eine seltsame Spannung in der Luft, der Boden bebte. Sie blieb stehen, lauschte, starrte nach vorne in die Dunkelheit und versuchte etwas zu erkennen. Nichts. Sie atmete tief ein und aus, schüttelte den Kopf, um die Angst abzuschütteln und setzte ihren Weg fort.
Sie wusste selbst nicht, warum die Nacht sie auf einmal so fürchterlich einschüchterte. Früher, als sie noch ein Kind gewesen war, ist sie gerne unerlaubt durch die stockfinsteren Gassen gehuscht, hat Schattenspiele beobachtet und mit Joshua verstecken gespielt. Doch heute war die Nacht irgendwie anders. Geladen. Zudem kam das leichte beben des Bodens, das sie sich nicht einzubilden glaubte.
Als sie nur noch einige Meter von Joshuas zu Hause trennte, hörte sie in der ferne ein dumpfes Donnern und Dröhnen, das rasch lauter zu werden schien. Verwirrt starrte sie in die Dunkelheit, bemerkte, dass sich um sie herum die Türen der Häuser öffneten und neugierige Bewohner ihre Köpfe hinausstreckten.
„Da kommt jemand“, murmelte eine Frau, die hinter Mia ins Freie trat. Einige anderen folgten ihrem Beispiel, sodass sich nach kurzer Zeit ein kleiner Halbkreis von mehreren Menschen bildete, die allesamt neugierig nach vorne starrten und mit ihren Blicken die Dunkelheit zu durchforsten begannen. Das Donnern wurde von Sekunde zu Sekunde lauter und schließlich erkannte Mia, um was es sich dabei handelte. Als man nach und nach wildes Rufen und das knallen der Peitschen ausmachen konnte, entkrampften sich ihre Muskeln. Es waren die Jäger, die von ihrem Beutezug zurückkehrten.
Doch von einem Moment auf den anderen erblasste sie. Was trieb sie dazu, ihre Pferde in so einem rasanten Tempo auf das Dorf zu lenken? Was im Namen Gottes musste passiert sein, dass sie ihre Reittiere nach einem so langen Marsch noch das Letzte abverlangten? Sie erschauderte. Es war nicht einfach, genug Fleisch zu finden. Die Männer mussten meistens ins weit entfernte Gebirge ziehen, um genug gesundes Wild jagen zu können. Und so weit von der Heimat entfernt gab es viele Gefahren. Nicht nur die nächtliche Kälte verlangte ab und an ihren Tribut, sondern auch die wilden Tiere und die anderen Wesen, die dort oben im Westen ihre Heimat gefunden hatten, die sich ganz gewiss nicht vor einer größeren Ansammlung von Menschen fürchteten und ohne zu zögern angriffen, wenn der Hunger oder die Mordlust sie dazu trieb.
Es musste etwas passiert sein.
„Mia“, Joshua tauchte neben ihr auf und zog sie mit einem Arm an sich, sodass er sie mit seinem Körper ein wenig vor dem eisigen Wind schützen konnte. Es waren keine Worte nötig. Sie wusste, dass er genau dasselbe dachte wie sie. Sie konnte es an seinen angespannten Muskeln erkennen, an seinen fest aufeinander gepressten Lippen. Sie lehnte ihren Kopf an seine Brust und wartete schweigend.
Es dauert nur noch einige Minuten, bis man schließlich im Dunkeln die mächtigen Leiber der Pferde erkennen konnte, die im rasanten Tempo auf sie zu jagten und schließlich mit schäumenden Mäulern und lautem Kreischen vor ihnen zu stehen kamen. Einige vor ihnen bäumten sich auf, wieherten schrill und warfen unruhig den Kopf hin und her.
„Dunken, oh Dunken!“ Eine üppige Frau löste sich aus der Menge und griff in die Zügel eines mächtigen, schwarzen Hengstes, dem der weiße Schaum in großen Mengen an den Nüstern klebte. „Um Himmels Willen, was ist den passiert, Dunken?“ Mia konnte erkennen, dass es sich um Sibyll handelte, die panisch zu ihrem Mann hinauf schrie und ungeduldig keine Antwort abwarten konnte. „So sag doch was. Dunken!“
„Halts Maul!“, stieß der große, muskulöse Mann auf dem schwarzen Ross aus. Er schwang sich mit einer Bewegung vom Rücken seines Tieres und landete sicher auf dem Boden. „Durch dein hysterisches Geschrei verschreckst du nicht nur die Pferde, sondern alle anderen hier! Wo ist Riddick und die anderen Männer, die hier geblieben sind?“ Er erhielt keine Antwort von der erstarrten Menschenmenge. „Verdammt!“, fluchte er und erkämpfte sich unsanft einen Weg durch die Masse. „Riddick!“, schrie er und schaute sich ungeduldig um.
„Timophey“, die Stimme kam aus dem Dunkeln. Hinter einem Haus trat ein Mann mittleren alters hervor, der sich mit verschränkten Armen an die Wand lehnte und Dunken Timophey mit undefinierbaren Blick beäugte. „Was kann ich tun?“
Einen Moment schaute sich der stattliche Mann um, verwirrt, weil er nicht ausmachen konnte, von wo die Stimme erklang. Doch schließlich konnte er Evander Riddick erkennen und eilte auf ihn zu. „Hol deine Waffe und die anderen Männer. Wir bekommen Besuch und unsere Munition ist längst aufgebraucht.“
Der letzte Satz löste die Erstarrung der übrigen Menschen. Einen Raunen ging durch die Menge, dann wildes Stimmengewirr.
„Was hat das zu bedeuten?“, fragte Mia, obwohl sie die Antwort längst kannte.
„Ein Neuling“, hauchte Joshua und zog seine Freundin fester an sich. Sie spürte wie er Ausschau nach seinem Vater hielt, der sich ebenfalls unter den Reitern befinden musste.
„Dort hinten“, sagte sie und deutete in Richtung einer braunen Stute, auf der ein älterer Mann saß. Er trug einen kurzen, grauen Bart, hatte das Gewehr über die Schulter gelegt und schaute erschöpft von oben auf die übrigen Männer hinab, die bereits festen Boden unter den Füßen hatten und versuchten, ihre Tiere zu beruhigen, die von der letzten Anstrengung völlig zerstört waren und kurz vor dem Kollaps standen.
Joshua nickte und kämpfte sich mit Mia an seiner Seite einen Weg zu seinem Vater. „Dad“, sagte er, als sie ihn schließlich erreicht hatten.
„Oh, Junge!“, schnaufte dieser. „Hilf deinem alten Herren herunter. Meine Beine sind völlig taub.“ Widerstrebend ließ Josh seine Freundin los, um dem Wunsch seines Vaters nachzukommen.
„Ah“, schnaufte dieser, als er auf seinen eigenen zwei Beinen stand. Er legte die Hand in den Rücken und reckte sich. „Ich befürchte, ich werde langsam zu alt für die Jagd. So lange und rasante Ritte bekommen mir nicht mehr.“ Er machte eine kurze Pause und schaute zum ersten Mal seinen Sohn und seine Freundin richtig an. „Ich hoffe dir geht es gut, Joshua? Und dir Natürlich auch, Mia. Wie geht es deiner Familie?“
„Ähm“, Mia schüttelte verwirrt den Kopf und wollte etwas erwidern, doch Josh kam ihr zuvor: „Dad, jetzt ist wohl kaum der richtige Zeitpunkt für smalltalk. Was geht hier vor?“
„Du hast recht, meine Junge. Du hast ja recht“, entgegnete dieser und nickte bedächtig. „Hier, nimm die Zügel. Nicht, dass sie uns nachher noch davon läuft.“ Er drückte seinem Sohn die Stute in die Hand und lehnte sich auf sein Gewehr. „Auf den letzten Kilometern nach Hause, auf dem Hauptweg sahen wir einen Unbekannten. Er hatte keine Sachen bei sich, nur die Kleider, die er am eigenen Leib trug. Er sah ziemlich sauber und gepflegt aus für einen Menschen, der wohl schon Kilometer weit durch die Wildnis geirrt sein musste. Wir hielten nicht an, wir gingen nicht zu ihm, sondern nahmen den Pfad, der uns im sicheren Abstand an ihm vorbei nach Hause bringen würde. Uns war bewusst, dass er früher oder später hier ankommen würde und da wir nicht wussten, in welchem Tempo er unsere Heimat erreichen konnte, trieb Timophey unsere Gruppe zum Äußersten an. Er wollte keine Zeit verlieren und das aus guten Gründen. Der Fremde ist nur noch einige Meter entfernt - wer weiß, was er getan hätte, wenn er unsere Frauen und Kinder fast schutzlos vorgefunden hätte? Wie auch immer“, schloss er. „In meinen Augen sah er eigentlich ziemlich ungefährlich aus - wie ein stinknormaler Mensch.“ Er brach ab und zuckte mit den Schultern. „Das einzige was mich beunruhigte war der riesige Wolf, der um ihn herumschwänzelte. Gewaltige Bestie, der ich nicht alleine nachts begegnen wollte.“
Mia fröstelte. Ohne Zweifel musste der Fremde einer anderen Anderen sein. Kein normaler Mensch würde alleine durch die Wildnis irren - oder in Begleitung eines riesigen Tieres. Dass Timophey die Truppe zur Eile angetrieben hatte war somit ziemlich verständlich. Niemand wusste, was der Unbekannte hier wollte, keiner Wusste, welche Macht dieser vielleicht besaß.
In der Luft lag erdrückende Angst, Anspannung, doch genau so konnte Mia in den Gesichtern einiger Bewohner die Neugierde aufblitzen sehen. Niemand von ihnen war jemals einem der anderen begegnet.
Die Nachricht von dem neuen Unbekannten, der auf dem Weg direkt zu ihnen war, verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Aus allen Gassen und Häusern strömten Frauen und Männer, die die Pferde schnappten und in das Zentrum führten, wo sich der gewaltige Speicher befand. Dort entluden sie die Tiere und brachten sie nacheinander in die sichere Unterkunft der Ställe, wo sie sich von der langen Reise erholen sollten.Das frische Fleisch das die Männer mitgebracht hatten wurde erstmals provisorisch in dem großen Gebäude untergebracht - man wollte sich später richtig darum kümmern. Alle wollten dabei sein, wenn der Fremde das Dorf erreichte.
In dieser Nacht herrschte ein wildes Durcheinander. Menschen irrten von einem Gebäude zum anderen, redeten wirr durcheinander und versetzten sich gegenseitig in Panik. Nach und nach schlich ein Gerücht herum, dass Satan höchstpersönlich auf den Weg zu ihnen war, mit dem Wolf als Vollstrecker seines Willens, um alle nacheinander dem Tode zu weihen.
Joshua und Mia warteten am westlichen Eingang des Dorfes, dort wo die Reiter angekommen waren und ließen sich nicht von den irren Geschichten der Bewohner beeinflussen.
„Es wäre sicherer, wenn du und deine Familie nach Hause gehen würdest“, meinte Josh zu seiner Freundin. Diese erwiderte nichts sondern verdrehte nur die Augen. Die anfängliche Panik, die von ihr Besitz ergriffen hatte, als die Nachricht von dem Unbekannten eingeschlagen war, war verschwunden. Eine gespannte Neugier hatte von ihr Besitz ergriffen, die alle Angst in ihr vertrieb.
Nicht anders zu erwarten war Joshua dagegen eine tickende Zeitbombe. Seine Muskeln waren verkrampft, seine Gesichtszüge verhärtet, seine Stimme bedrückt.
„Du solltest das nicht so auf die leichte Schulter nehmen, Mia“, sagte er sauer.
„Ich gebe das nicht gerne zu, Mia, aber dein Freund hat recht“, mischte sich ihr Vater ein, der sich zusammen mit Yvaine zu ihnen gestellt hatte. „Niemand weiß, was heute Nacht passieren wird. Angst wäre da das Mindeste, was du empfinden solltest.“ Seine Stimme klang streng und seine Augen blitzten wütend. Auch er war angespannt, nervös. An seinem Gürtel blitzte der Revolver auf, der bereits mehrere Jahrzehnte der Familie gehörte. Tyron holte ihn nicht oft zum Vorschein - dafür existierte nur noch zu wenig Munition, die er sich für den Notfall aufheben musste. Dass er die Waffe nun heraus gekramt hatte, zeigte Mia, wie ernst er diese Situation nahm. Doch eigentlich, verwundete sie dies nicht. Das Gespräch heute Mittag, der Streit, die Diskussion über die Anderen hatte ihr nur wieder zu gut gezeigt, dass ihr Vater seine Vorurteile nicht so schnell ablegen würde.
Nach und nach bildeten die Bewohner eine Art Formation. Jugendliche, Frauen und Kinder formten die hinteren Reihen. Die Männer stellten sich mit frischbeladenen Waffen an die vorderste Front und blickten grimmig nach vorne in die Dunkelheit, bereit, ihre Familie vor dem grausamen Ungeheuer, das auf sie zusteuerte, zu beschützen und dafür sogar ihr Leben zu opfern.
„Das ist doch albern…“, murmelte Mia. Joshua drückte sie mahnend am Arm und zischte „Pscht“. Es war mucksmäuschenstill. Alle schwiegen gespannt, erpicht darauf als Erstes ein Geräusch ausmachen zu können oder etwas in der Dunkelheit zu erblicken. Der eisige Wind jagte nach wie vor durch die Straßen, zerrte an Mias langen, braunen Haaren und riss ihr die Decke fast von den Schultern. Der Kauz stob auf, schoss in die Höhe und verschwand im nächtlichen Himmel. Die Wolken zogen fort, sodass der riesige Vollmond in Sicht kam und die Umgebung erhellte.
Und plötzlich konnte man ihn sehen. Einen großen, muskulösen Mann, die Haare zerzaust vom Wind, schwarz wie die Nacht. Er wirkte mächtig, einschüchternd, wie er mit großen Schritten auf die Bewohner zueilte, in Begleitung eines gewaltigen, weißen Wolfes. Seine Bewegungen waren geschmeidig, wie die eines Jägers. Er machte kaum Geräusche, war leise wie ein Luchs. Ein Zucken ging durch die Menge, als sich die Muskeln aller schlagartig verkrampften und sich die Angst wie ein stechender Geruch weiter ausbreitete. Die Männer legten die Gewehre an und diejenigen, die keine Feuerwaffen oder Munition mehr besaßen, zückten die Schwerter, gingen in die Angriffshaltung über.
Erst einige Meter vor den Bewohnern, hielt der Fremde inne, hob den gesenkten Blick vom Boden. Seine Augen huschten wie Blitze über die Menschenmenge, schienen jedes Detail, jede kleinste Bewegung, jeden Atemzug wahrzunehmen. Der Mond erhellte sein ernstes, kantiges Gesicht. Seine Hände zuckten. Er kräuselte die Nase, schaute sich um… und lächelte. „Was für eine freundliche Begrüßung“, sagte er sarkastisch. Seine Stimme war tief und dunkel, hatte etwas Rauchiges, das Mia eine Gänsehaut über Arme und Beine jagte. Sie konnte hören, wie sich der Wolf neben ihm duckte und bedrohlich in Richtung der bewaffneten Männer knurrte. Dann sah sie, wie sich die Lippen des Mannes langsam und schnell bewegten, als würde er etwas sagen. Daraufhin entspannte sich das mächtige Tier und setzte sich auf die Hinterhand, ohne einen weiteren Mucks von sich zu geben.
Ein kurzes Schweigen entstand.
„Wer bist du?“ Es war Dunkens Stimme, die als erstes ertönte. Mit angelegtem Gewehr trat es einen Schritt vor. Evander und die restlichen Männer taten es ihm nach.
„Wer bin ich, woher komme ich… alles Fragen, die ich schon zu oft gehört habe. Doch was spielt das für eine Rolle? Das Einzige was zählt ist doch, was ich hier will“, er grinste hämisch, wobei seine perlweißen Zähne im Licht aufblitzten. Es schien, als würde ihn die Angst der Bewohner amüsieren. „Nun gut“, ein Ruck ging durch seinen Körper. „Mein Name ist Damian.“ Er lächelte finster, doch wischte es kurz darauf wieder aus dem Gesicht, als wäre es nur ein Ausrutscher gewesen. „Mit wem habe ich die Ehre?“
„Verschwinde von hier, du hast hier nichts zu suchen“, fuhr Dunken ihn an und machte einen weiteren Schritt auf ihn zu. „Wir dulden hier keine Neulinge.“
„Das ist schade“, erwiderte der Fremde und wandte seinen Blick von Timophey ab, um nochmals die übrige Menschen zu mustern. Mia schien, als würde er etwas suchen. „Ich muss hier eine unbekannte Zeit meine Zelte aufschlagen - da hatte ich gehofft, auf einen nicht allzu großen Widerstand zu stoßen. Es wäre schade, wenn wir uns in Zukunft die Tage gegenseitig zur Hölle machen würden. Oder nicht?“
Dunken knurrte. „Verschwinde, oder ich kann dir für nichts garantieren“, drohte er. Mia erkannte wie dumm diese Aktion war, denn der Wolf neben dem Fremden schien sensibel auf den gefährlichen Ton in Timopheys Stimme zu reagieren. Er sprang auf, sträubte das Fell und duckte sich vor seinen Herren, bereit mit einem Satz die Kehle des Feindes zu durchtrennen. Die blitzartige Reaktion des Tieres verschreckte die gesamten Männer. Sie traten einige Schritt zurück, angespannt, voller Furcht. Marcel Timophey, der glatzköpfige Schlachter des Dorfes und Bruder von Dunken richtete sein Gewehr auf den Kopf des Wolfes und zischte: „Eine Bewegung und das Biest ist tot!“ Drohend legte er den Zeigefinger auf den Abzug und fixierte den Wolf.
Selbst von der weiten Entfernung sah Mia die Wut in die Augen des Fremden aufsteigen. Seine entspannte Haltung wisch einer lauernden Anspannung. Sie war sich sicher, dass er binnen einer kleinsten Sekunde, Marcel den Kopf abreisen könnte, bevor dieser überhaupt die Chance dazu haben würde, den Abzug zu betätigen.
„Ihr seid nicht in der richtigen Position, um Drohungen aussprechen zu können.“ Damians Stimme war gesenkt, leise, düster, gefährlich. Er kniff die Augen leicht zusammen, starrte in Marcels Richtung und schien einen Moment mit einem Gedanken zu spielen, dessen Ausführung sicherlich ein großes Blutvergießen bedeutet hätte.
Marcel lachte noch kurz, nahm dann schließlich den Finger vom Abzug, ließ das Gewehr allerdings in Position.
„Es ist spät. Das Beste wäre, ihr würdet in eure Häuser zurückkehren. Ich gebe euch mein Wort, dass von mir keine Bedrohung ausgeht, solang man mich und meine Wölfin in Ruhe lässt.“
„Dein Wort“, Dunken lachte hämisch auf und schüttelte den Kopf. „Dein Wort ist nichts wert, Bestie. Verschwinde. Du wirst hier nicht geduldet.“
Die weiße Wölfin knurrte und diesmal rief Damian sie nicht zur Ruhe, sondern ließ sie gewähren. „Euch wird nichts anderes übrig bleiben“, entgegnete er.
Dann ging alles ganz schnell. Marcel platzte die Geduld, ließ seiner Wut, seinem Hass auf diesen Fremden freien Lauf und legte den Finger auf den Abzug, um dem weißen Monster den gar aus zu machen. Doch bevor die Kugel in das dichte Fell einschlagen konnte, landete der Wolf mit einem gewaltigen Satz auf dem Mann, riss ihn zu Boden und schleuderte dabei das Gewehr zur Seite. Blitzschnell riss Dukan seine Waffe herum, um seinem Bruder zur Hilfe zu eilen, legte an, zielte und wurde seitlich von einem gewaltigen Schlag getroffen, sodass ihm die Flinte aus den Händen rutschte. Damians rechte Hand schloss sich um die Kehle des Mannes und hob ihn ohne weitere Anstrengung vom Boden. „Eine weitere Bewegung und die Beiden sind tot“, drohte er. Sein Körper war ruhig, es schien, als wäre er zu einer Salzsäule erstarrt. Doch Mia wusste, dass er jede kleinste Bewegung, jedes leiseste Geräusch wahrnehmen konnte und ohne zu zögern darauf reagieren würde.
Einen Moment passierte gar nichts. Marcel lag wimmernd auf dem Boden, über sich der gewaltige Wolf, der ihn mit seinen Pranken auf den Boden drückte und die Lefzen zurückgezogen hatte, und Dunken hing in der Luft, unfähig sich zu bewegen, unfähig nach Luft zu schnappen.
Die Männer schnappten nach Luft, wollten mutig Schwerter und Gewehre erheben und sich auf den Fremden stürzen. Doch Evander schüttelte stumm den Kopf und machte mit einer kurzen Handbewegung klar, dass es keinen Kampf geben würde. „Lasst die Waffen fallen“, befahl er. Einen Moment zögerten sie noch, doch letztendlich befolgten sie seinem Befehl. Auch Riddick senkte das Gewehr und sprach Damian direkt an: „Du kannst so lange bleiben, wie es für dich nötig ist. Du darfst dich frei in unserer Heimat bewegen, darfst mit uns speisen, unter uns schlafen.“ Er machte eine kurze, bedeutsame Pause und fuhr schließlich fort: „Doch rührst du nur einmal, nur ein einziges Mal unsere Familien, unsere Kinder oder unseren Besitz an, wirst du dieses Dorf nicht lebend verlassen - weder du, noch dein Wolf. Versteh das nicht als leere Drohung - das wäre ein großer Fehler. Versteh es besser als… ein Versprechen.“ Mit diesen Worten wandte er sich ab, schob sich durch die Menge und verschwand aus Mias Blickfeld.
Einen kurzen Moment später, stieß Damian Dunken von sich und ließ ihn los. Er glitt röchelnd und hustend zu Boden, schnappte gequält nach Luft und stöhnte. Auch die Wölfin ließ Marcel frei und schlappte seelenruhig zu ihrem Herren zurück. „Dann wünsche ich euch allesamt eine angenehme, restliche Nacht“, wieder umhüllte ein sarkastisches Lächeln seine Lippen. Er wandte sich ab und ging in Richtung des Zentrums. Der weiße Wolf folgte ihm.
Nachdem die Beiden aus dem Blickfeld verschwunden waren, stürzte Sibyll hervor, und stürzte leichenblass zu ihrem Mann, der immer noch am Boden lag. „Oh, Dunken, Dunken!“ Hektisch kniete sie sich neben ihn und strich ihm mit den Händen über das Gesicht. „So sag doch was, mein Schatz!“ Doch dieser schob sie nur grob von sich und richtete sich auf. „Nimm deine Finger von mir, Frau!“, zischte er und hustete erneut. „Geh nach Hause und koch mir was. Ich brauche eine Stärkung!“ Sibyll senkte den Kopf, nickte und lief mit eiligen Schritten davon. Mia schnürte sich die Kehle zusammen, als sie der jungen, üppigen Frau hinterher blickte. Sie konnte zwar nicht verleugnen, dass sie mit ihrer hysterischen Art ein wenig übertrieb, doch war das noch lange kein Grund, sie so schlecht zu behandeln, wie ihr Mann es tat. Es kam nicht selten vor, dass sie mit einem blauen Augen auf die Straße lief und mit gesenktem Blick irgendwelche Erledigungen zu machen hatte. Niemand konnte verstehen, warum sie bei Dunken blieb und ihn nicht verließ.
Nachdem auch Marcel wieder auf seinen zwei Beinen stand, löste sich die Menge nach und nach langsam auf. Niemand ging alleine heimwärts - dazu war die Furcht vor dem Fremden, der nun unter ihnen weilte, zu groß. Einige von ihnen beschlossen sogar, nicht alleine zu schlafen, sondern zogen für die Nacht gemeinsam in ein und dasselbe Haus.
„Ich begleite euch nach Hause“, murmelte Joshua schließlich. „Mein Vater wird sich um meine Mutter kümmern.“
© rockundliebe.de - Impressum Datenschutz