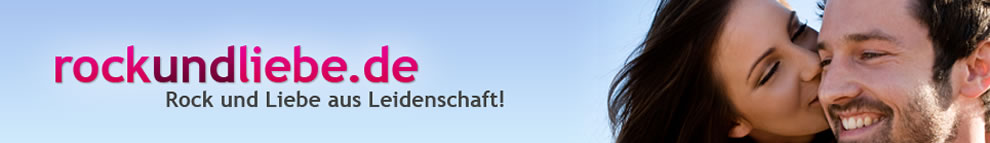
The Facets of Black - Teil 4
Autor: Ai
veröffentlicht am: 09.08.2013
Amanda
Im Wald ist es still. Ich kann einzig und allein den Wind hören, wie er sich durch das Geäst schlängelt und die Blätter zum Rauschen bringt. Ich weiß genau, wo ich hingehe. Dieser Wald ist so etwas wie meine zweite Heimat, oder meine einzige richtige. Wie man es nimmt.
Mein Weg führt mich zu dem großen Ahornbaum, der mit seiner Krone alle Anderen überragt. Der dicke Stamm hat sich mit großen Wurzeln fest in den Boden gegraben. Schon allein dieser Gedanke gibt mir ein Gefühl von Sicherheit, wie es mir mein Zuhause, meine Mutter nie geben könnten.
Ich lehne mich an den mächtigen Stamm und gleite langsam an ihm zu Boden. Die Erde ist feucht. In der Nacht hat es geregnet und die Sonne kam nicht durch das dichte Blätterdach. Ich lasse meinen Kopf in den Nacken fallen und atme einmal tief durch. Atme den Duft des Waldes, des Windes und des Lebens ein, dass mich umgibt. Es tut so gut, dass Alles um mich zu spüren.
Das Knacken eines Astes verrät mir, dass ich nicht alleine bin. Jemand ist mir gefolgt. Ich kann seine Anwesenheit spüren und weiß sofort, wer es ist, denn es gibt niemanden sonst, der mir hierher folgen würde.
»Amanda?«, höre ich Erics Stimme etwa fünf Meter hinter mir. Nur der Stamm des Ahorns versperrt ihm die Sicht auf mich. Ich bleibe ruhig sitzen, in der Hoffnung, er würde wieder gehen. Doch dummerweise weiß er genau, dass wenn ich in den Wald gehe, ich mit Sicherheit bei diesem Baum bin. Seine Schritte nähern sich und ich ziehe meine Füße eng an mich, als würde das etwas helfen. »Amanda«, sagt er dann erleichtert, als er mich, an den Baumstamm gelehnt, entdeckt.
»Geh weg«, sage ich trotzig und würdige ihn keines Blickes.
Natürlich hört er nicht auf mich, ganz im Gegenteil, er kommt zu mir und setzt sich neben mich. »Was ist passiert?«, fragt er vorsichtig.
»Gar nicht«, brumme ich genervt. Er weiß genau, dass ich nicht reden will, wenn ich in den Wald gehe. Ich möchte vergessen und mich nicht erinnern.
Er sieht mich forschend an. Ich habe fast das Gefühl, seine Blicke durchbohren mich. Unwillkürlich ziehe ich meine Beine noch näher an mich heran und schlinge die Arme darum herum. »Du kannst es mir sagen«, flüstert er.
»Ich weiß«, flüstere ich zurück. Tränen steigen mir in die Augen, auch wenn ich geglaubt hatte, für heute wäre dieser Brunnen versiegt. »Ich will aber nicht.« Seufzend lehnt er sich an den Stamm und sieht hinauf zum Blätterdach. »Ich bin nicht dein Schützling«, sage ich genervt und schlucke die Tränen hinunter.
»Ich weiß«, sagt er nachdenklich, den Blick immer noch nach Oben gerichtet.
»Dann hör auf, mich so zu behandeln!«
»Ich will dir nur helfen.«
Es ist immer dieselbe Diskussion, seit wir uns kennen führen wir fast jeden Tag so ein Gespräch. »Ich will deine Hilfe aber nicht«, sage ich eindringlich, wohl wissend, dass es nichts bringen wird.
»Gut«, sagt er, steht auf und streckt mir eine Hand hin. »Wenn du schon nicht reden möchtest, dann komm wenigstens mit. Der Boden ist nass und kalt, du erkältest dich noch.«
Mürrisch sehe ich ihn an. Eigentlich würde ich viel lieber hier bleiben, doch ich weiß, dass er nicht locker lassen wird, bis ich mitkomme. Also stehe ich auf, ohne seine Hand zu beachten und gehe den Weg, den ich gekommen bin, zurück.
»Könntest du nur einmal die Hand nehmen, die ich dir anbiete?«, fragt Eric etwas verzweifelt. Dieser Satz hat zwei Bedeutungen. Einmal die offensichtlich, dass er mir seine Hand angeboten hat, um mir aufzuhelfen und zum anderen die, dass ich in keinerlei Hinsicht seine Hilfe möchte.
»Nein«, gebe ich knapp zurück und gehe unbeirrt weiter.
Eric folgt mir stumm, bis wir den Waldrand erreicht haben, sagt er kein Wort, worüber ich sehr froh bin. »Was ist mit dem Unterricht?«, fragt er, als wir langsam die Straße erreichen.
»Bis zur Mittagspause habe ich mir frei gegeben.«
»Verstehe«, sagt er nur und sieht stur gerade aus. Nein, er versteht nicht. Das liegt aber mehr an mir, als an ihm. Er kann mich gar nicht verstehen, weil er viel zu wenig über mich weiß. Aber ich will ihm nichts erzählen, weil ich nicht gerne erinnert werde. Trotzdem ist er der Mensch, der mich am allerbesten kennt. Besser als meine Eltern, besser als die Lehrer, besser als die ganze Welt. Weil er einfach nicht locker lässt.
»Lust auf einen Kaffee?«, fragt er, als wir bei dem kleinen Café, eine Querstraße von der Schule entfernt, vorbeikommen.
»Musst du nicht arbeiten?«, frage ich genervt. Ich hasse Cafés. Viel zu viele Menschen auf viel zu engem Raum.
Er grinst. »Müsstest du nicht in der Schule sein?«
Ich runzle skeptisch die Stirn. »Ist das dein Ernst?«
»Nein«, sagt er lachend und sieht mich an.
Ich verschränke trotzig meine Arme vor der Brust und sehe ihn beleidigt an. »Machst du dich über mich lustig?«
Er hört auf zu lachen und zieht skeptisch eine Augenbraue hoch. »Jetzt komm schon«, sagt er bittend und legt mir eine Hand auf meinen Rücken. Ich zucke zurück. Ich kann es nicht leiden, wenn mich jemand berührt. »Sorry«, sagt er erschrocken und zieht die Hand zurück. Er weiß genau, dass ich das nicht mag.
»Ich würde viel lieber woanders hingehen«, sage ich dann und starre geistesabwesend die Straße hinunter.
»Wie du willst. Das Café war nur ein Vorschlag.«
»Alleine«, füge ich trocken hinzu.
Ich kann aus dem Augenwinkel sehen, wie er erschrocken zurückweicht. »Oh.«
Ich nicke und gehe los. Er wird mir nicht folgen, das weiß ich. Das einzig Gute an seinem Job ist, dass er weiß, wann Schluss ist und dass er diese Grenze niemals überschreiten würde. Vielleicht ist genau diese Tatsache der Grund, warum es mir nicht so viel ausmacht, ihn um mich zu haben, auch wenn ich eigentlich lieber alleine bin.
Ich gehe die Straße entlang, sehe kein einziges Mal zurück. Ich weiß genau, dass er noch immer dort vor dem Café steht, mit der Hoffnung, dass ich doch noch zurückkomme und mit ihm hineingehe. Doch das wird nie passieren. Ich werde niemals in dieses Café gehen und auch in kein anderes.
Mein Weg führt mich ein paar Querstraßen weiter. In einer kleinen, unscheinbaren Seitengasse befindet sich, wo ich hin will. Es ist ein kleines Büchergeschäft. Alt, verstaubt, schlecht besucht. Und genau das ist der springende Punkt. Nie ist dort jemand, abgesehen von mir und der alten Dame, der der Laden gehört. Sie stellt keine Fragen, fängt keinen lästigen Smalltalk an. Sie sitzt einfach nur hinter der Kassa auf einem kleinen Hocker und liest ein Buch. Dieses Geschäft ist für mich mein zweiter Zufluchtsort neben dem Wald. Obwohl ich mich hier etwas beengt und nicht so frei, wie im Wald fühle, sind die alten, verstaubten Bücher Trost genug.
Meistens stöbere ich nur herum, Geld für eines der Bücher habe ich selten, doch das macht nichts. Mir reicht es schon, etwas in den Romanen zu blättern, ein paar Seiten zu lesen. Ich könnte den ganzen Tag hier verbringen, doch das geht leider nicht. Als es Mittag wird, verlasse ich den Laden wieder und gehe die paar Querstraßen zurück zur Schule. Auf mich warten jetzt noch eine Stunde Geographie und danach noch Physik. Mr. Renolds, der Geographielehrer, ist einer der besten Lehrer an der Schule, wie ich finde. Allerdings ist Mrs. Hant, die Physiklehrerin, sehr streng und erwartet immer volle Leistung. Ihr Unterricht ist immer furchtbar anstrengend, außerdem liegt mir dieses Fach so gar nicht.
Doch erst einmal kommt das Mittagessen in der Cafeteria auf mich zu. Eigentlich esse ich normalerweise im Innenhof, doch heute nehme ich, aus irgendeinem Grund, den ich selbst nicht kenne, an einem der Tische im Speisesaal Platz. Ich sitze etwas abseits an einem Tisch an der Wand, lese weiter Stolz und Vorurteil und beiße dabei immer wieder von meinem Putensandwich ab.
Ich bin wieder in meiner eigenen, kleinen Welt und eigentlich interessiert mich nicht, was rund um mich passiert. Doch als ich wieder einen Bissen mache, sehe ich unwillkürlich auf, zwei Tische vor mir sitzen ein paar Mädchen aus meinem Jahrgang. Ich kenne sie, ihre Namen aber nicht. Sie reden angeregt über etwas und werfen immer wieder verstohlene Blicke in meine Richtung. Sehr unauffällig, denke ich und widme mich wieder meinem Buch. Es ist doch immer dasselbe, bist du anders, wie auch immer, reden die Anderen über dich. Ich will doch nur einfach nichts mit ihnen zu tun haben, ist das so schlimm?
Ich bin mir nicht sicher, wie ich die letzten beiden Schulstunden überstanden habe, auf habe ich es irgendwie und stehe jetzt vor der Schule, den Blick starr und finster geradeaus gerichtet. Dort steht Eric. Manchmal, dass heißt eigentlich immer, geht er mir schon ganz schön auf die Nerven. Er grinst und winkt mir zu, als ich keine Anstalten mache, auf ihn zuzugehen.
»Was willst du hier?«, frage ich mürrisch, als er zu mir kommt.
»Ach komm schon«, sagt er gespielt beleidigt. »Sei doch nicht immer so gereizt.«
»Ich bin nicht gereizt, ich bin genervt«, gebe ich zurück.
»Wo ist da der Unterscheid?«
Ich funkle ihn böse an. Irgendwie fällt mir darauf keine gute Antwort ein. »Kannst du mich bitte einfach in Ruhe lassen?«
»Nein«, sagt er knapp.
»Warum nicht?«, frage ich genervt und lege die Stirn in Falten.
Er zuckt nur mit den Achseln. »Das wiederspricht meiner inneren Einstellung.«
Innere Einstellung, so ein Blödsinn. »Du hättest Philosoph werden sollen«, brumme ich und gehe an ihm vorbei, ohne weiter auf ihn zu achten.
»Wo willst du hin?«, fragt er entrüstet.
»Geht dich gar nichts an«, sage ich und werde immer schneller.
Eric nervt mich jetzt schon seit drei Jahren. Und genau so lange sage ich ihm, dass er sich verpissen soll. Es nützt einfach nichts. Sein Drang, armen, bedürftigen Kindern zu helfen, ist einfach zu groß, obwohl ich weder arm, noch bedürftig bin, zumiendestens nicht körperlich.
»Amanda, warte!«, ruft er und kommt mir hinterher gerannt. Er legt mir eine Hand auf die Schulter, um mich aufzuhalten. Ich zucke zusammen und bleibe stehen. »Lass mich dich wenigstens nach Hause bringen.«
Ich sehe ihn eiskalt an und spüre, wie sich Unwohlsein in ihm ausbreitet. Von der Schule bis zu mir nach Hause ist es relativ weit. Der Schulbus fährt eine halbe Stunde, doch ich hasse den Bus. Deshalb gehe ich fast immer zu fuß.
»Bitte«, presst er gequält heraus. Ich weiß genau, wie schlecht er sich fühlt, weil er genau so gut wie ich weiß, dass er mir nicht helfen kann, auch wenn er es noch so versucht. Sein Beruf und das Wissen, das er dadurch hat, machen die Sache nicht leichter.
Er ist Sozialarbeiter und genau das ist der Grund, warum er mich überhaupt erst vor drei Jahren angesprochen hat. Körperlich geht es mir halbwegs gut, was auch nicht immer so war, aber die seelischen Narben verheilen nicht so schnell, vielleicht sogar nie.
»Nein.« Ohne ein weiteres Wort setze ich meinen Weg fort. Ich brauche die Zeit für mich allein. Alleine fühle ich mich einfach am wohlsten. Das war nicht immer so, aber es ist schon lange so.
»Mandy? Bist du das?«, höre ich meine Mutter aus dem Wohnzimmer rufen, als ich die Haustür aufsperre.
Seufzend lege ich den Schlüssel auf das Tischchen neben der Tür. »Ja Mum, wer sonst?« Es gibt niemanden, der es sonst hätte sein können. Ich wohne alleine mit meiner Mutter in diesem Haus, seit sieben Jahren. Niemand sonst hat einen Schlüssel. Die Psychopharmaka wirken.
»Oh Mandy, Schätzchen, ich habe einen Kuchen gebacken«, erzählt mir meine Mutter freudestrahlend, als ich in die Küche komme. Sie hat die Backform gerade aus dem Ofen genommen. »Sie nur, Schokoladenkuchen, den magst du doch so gerne.« Sie hält mir die Form hin und ich atme den köstlichen Duft des fertigen Kuchens ein. Schokoladenkuchen mochte ich als Kind sehr gerne, aber ich habe schon lange keinen mehr gegessen. Das hat seinen Grund. Alles hat seinen Grund.
»Ich möchte jetzt nichts, Mum«, sage ich abwehrend.
»Aber Schätzchen, ich habe mir doch so viel Mühe gegeben«, sagt sie traurig und sieht mich mit ihrem Dackelblick an.
Es sieht jetzt so aus, als wäre sie die fürsorgliche Mutter und ich das undankbare Kind. Ich muss schmunzeln bei dem Gedanken, denn sie ist keine gute Mutter. Nie wirklich gewesen. Seit ihr zweiter Mann gestorben ist, ist sie in psychatrischer Behandlung. An ihren guten Tagen, so wie heute einer zu sein scheint, ist sie fröhlich, backt Kuchen und lächelt mich an. Diese Tage sind selten. Meistens finde ich sie verweint in ihrem Bett vor. Sie trauert über so vieles. Darüber, dass mein Vater sie vor 14 Jahren verlassen hat, darüber, dass ihr zweiter Mann, Paul, tot ist und das ihr Leben eigentlich gar keinen Sinn mehr macht. Eigentlich hätte sie schon nach der Scheidung von Dad eine Therapie gebraucht. Aber die hat sie nicht bekommen und so haben wir ein halbes Jahr im Dreck gelebt, weil sie einfach zu nichts mehr fähig war. Doch dann kam Paul und sie hat wieder einen Sinn in ihrem Leben gesehen. Ich war für sie nie wichtig genug, um mich als diesen Sinn anzuerkennen. Doch Paul war es und dadurch kehrte wieder ein Stück Normalität in unser Leben ein. Das hört sich jetzt vielleicht so an, als ob Paul der strahlende Ritter in goldener Rüstung gewesen wäre, der Mum aus der Verzweiflung und mich aus dem Dreck gehoben hat, das war er aber nicht. Ganz und gar nicht.
Teil 1 Teil 2 Teil 3 Teil 4 Teil 5
© rockundliebe.de - Impressum Datenschutz