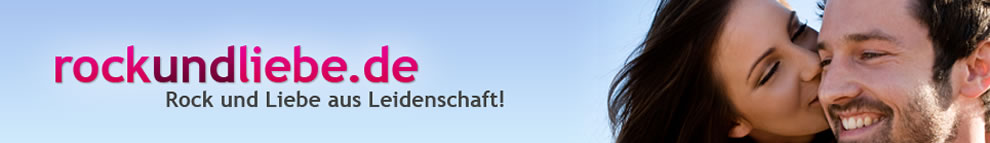
Gefangen in meinem eigenen Leben - Teil 5
Autor: Regentanz<3
veröffentlicht am: 12.08.2013
Es war unaufhaltsam. Das Gefühl, dass man mich nicht lieben konnte. Wie sollte man auch? Was war ich schon?! Es war mir wahrhaftig an diesem Weihnachten klar geworden. Dass ich es nicht würdig war geliebt zu werden. Tatsachen über Tatsachen. Er hasste mich. Und nicht nur er. Auch ich. Ich hasste mich, wie ich ihn anfing zu hassen. Nie würde ich das Gefühl von diesem Hass vergessen können. Seit dem Wochenende im Herbst, nach diesem Weihnachtsfest. Ich wünschte, dass ich noch so viel mehr Beispiele nennen könnte, aber ich fing an die Sachen zu vergessen…
Ich war schon ganze 5 Jahre alt, bald würde ich 6 werden. Doch freuen konnte ich mich bei besten Willen nicht. Die Eltern von Mama wohnten in Wittenberge. In einem Hochhaus. Ich war liebend gerne dort gewesen, wenn ich bei meinem Opa war, der immer gesagt hatte, dass meine Augen den Sternen glichen, dann fühlte ich mich zu Hause. Ich liebte ihn. Sehr sogar. Doch nur allzu schnell merkte ich, dass ich es nicht verdient hatte, glücklich zu sein.
Wir gingen den abgedunkelten Flur entlang, auf direktem Weg zum Schlafzimmer von Oma und Opa. Mein Bauch fing an wieder wehzutun. Irgendetwas stimmte hier ganz und gar nicht. Opi lag wie immer im Bett, eine Tüte mit komischem Wasser hing neben ihm. Was sollte die da? Er öffnete kurz die Augen, als wir hereinkamen. Mami und Franzi, die mitgekommen waren, gingen leise an sein Bett und umarmten ihn ganz vorsichtig. Es ging ihm wieder schlechter. Mein Herz sackte eine Etage tiefer. Oh nein! Wer hatte so etwas Schlimmes mit meinem Opi gemacht? Vor wenigen Monaten, als ich bei Oma und Opa war, waren wir noch mit seinem beigen Trabbi zu seiner Lieblingsstelle gefahren. Da, wo die Kraniche an einem Tag Rast machten, um in den Süden zu fliegen. Es waren seine Lieblingstiere. Gerade war die Sonne untergegangen, als wir angekommen waren. Opi machte ein paar Bilder, während ich seinen Stock hielt.
„Er stützt ihn, Opa kann nicht mehr so gut gehen. Der Stock ist wichtig für ihn!“, hatte Mama mir erzählt, als ich sie gefragt hatte, warum Opa einen Stock in der Hand hielt und ob er jetzt, wie wir im Sommerurlaub immer in Tschechien wandern gehen wollte.
Und jetzt, ein paar Monate später lag er im Bett und wollte nicht mehr aufstehen.
Seine Wange war heißer, als sonst, aber er lächelte mich an.
„Jetzt schau mich nicht so an, es geht mir gut.“, er lächelte dünn. Ich schlag die Arme um seinen Bauch und fing an zu weinen. Wer hatte so etwas Böses mit ihm gemacht?!
Wenige Wochen später sah ich ihn ein letztes Mal. Im Krankenhaus. Zu unserem letzten Besuch. Er hatte zufrieden gelächelt, als wir hereingekommen waren. Franzi hatte ihm noch extra einen schö-nen, weichen und bunten Schal gestrickt, das hatte er sich sehr gewünscht. Ich hatte ein ganz schö-nes Bild für ihn gemalt. Zum Abschied hatte er mich umarmt, ganz fest und mir ins Ohr geflüstert, dass er immer da war, auch wenn ich ihn mal nicht sah. Wir hatten alle geweint. Ich konnte nicht verstehen, warum es sich wie ein Abschied für immer angefühlt hatte. Ich wollte es auch gar nicht verstehen.
Meinem Vater war der Tod meines Opas, gleichzeitig der Vater seiner Ehefrau völlig egal. Er fragte uns immer, warum wir noch heulten, er sei doch eh schon weg, wir sollten uns freuen. Einmal, als seine Tochter Tina, gleichzeitig meine Halbschwester zu Besuch kam, lachten sie uns zusammen aus. Weil jemand gestorben war, der uns wichtig gewesen war. Meine Mutter hatte schrecklich geweint.
Irgendwie kam ich darüber hinweg. Auch die Tatsache, dass ich Monate nach Opas Tod im Kindergarten nach seinem Befinden ausgefragt wurde. Manchmal hatte ich das Gefühl, dass sie nur wollten, dass es mir noch schlechter ging. Dann legte ich mich immer einfach auf die Wiese, sah zu den Wolken nach oben und fragte mich, warum er einfach gegangen war. Warum er nicht mehr für mich da war. Und ich fragte mich gleichzeitig, ob er mich gerade in diesem Moment, wo ich im Gras lag, Hummeln und Schmetterlinge neben mir flogen, ob er mich gerade dann sah. Und ich hoffte, dass er wusste, wie lieb ich ihn habe und wie sehr ich ihn vermisse. Heute noch.
Gerne erinnerte ich mich als Kind daran, wie Opa und ich etwas unternommen hatten. Kraniche waren seine Lieblingstiere gewesen. Wir hatten sie uns oft angesehen, während die Sonne unterging. Mit seinem alten Trabbi waren wir zu unserer Geheimstelle gefahren, hinter einem alten, roten Backsteinhaus und hatten die Kraniche bewundert.
„Wenn ich ein Tier sein dürfte, dann wäre ich ein Kranich.“, hatte er dann immer gesagt und ich hatte seine Hand ganz fest in meine genommen, die Hand, in der nicht sein Stock war. Dann waren wir zurück zu Oma gefahren und hatten Abendbrot gegessen. Opa hatte so viel gegessen! Und Oma meinte dann immer:
„Werner! Iss nicht so viel! Du wirst sonst zu dick!“ Doch Opa hatte immer nur gelacht und sich seine Honigstulle gemacht. Dann war es immer für einige Minuten beängstigend still gewesen, lediglich die Wanduhr hatte getickt. Doch Opa zwinkerte mir zu und ich konnte mich entspannen. Ich mochte es nicht, wenn es ruhig war.
Nach seinem Tod jedoch war kein Opa mehr da, der mit mir Kraniche gucken ging. Kein Opa, der mir zuzwinkerte, wenn nur noch das Ticken der Uhr zu hören war. Nicht nur die Betthälfte neben Oma blieb leer. Sondern auch ein großer Platz in meinem Herzen, der durch ihn vorher gefüllt gewesen war. Doch seit seinem Tod war mir das Sterben selbst nicht mehr schlimm vorgekommen. Im Gegenteil: Ich hatte mich darauf gefreut. Ich würde endlich meinen Opa sehen können. Der wartete nämlich auf mich. Auf seiner großen Wolke und abends auf dem hellsten Stern am Himmel. Meine Schwester Franzi hatte das gesagt. Und sie würde mich nicht anlügen! Noch heute bin ich mir sicher, dass er irgendwo dort oben sitzt und auf seine Frau, seine Töchter, seinen Sohn und seine 3 Enkelkinder wartet. Mit dem gleichen Lächeln auf den Lippen, wie die, an die ich mich erinnern kann. Nur ohne die Traurigkeit.
Teil 1 Teil 2 Teil 3 Teil 4 Teil 5
© rockundliebe.de - Impressum Datenschutz